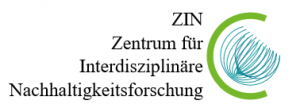Marco Sonnberger, Matthias Leger, Nils Stockmann
Mit unserem Beitrag möchten wir (die Nachwuchsforschungsgruppe „DynaMo“), an Doris Fuchs‘ Beitrag „Was bleibt?“ anknüpfen und die dortigen Überlegungen weiterdenken. Mittels einer praxistheoretischen Betrachtung wollen wir aufzeigen, inwiefern Krisensituationen – wie die derzeitige Corona-Pandemie – das Potential haben, alltägliche Praktiken zu verändern, indem sie die oft unbewusste, routinierte Dimension des Alltags irritieren, diese diskutierbar und der Möglichkeit einer Veränderung zugänglich machen. Vor diesem Hintergrund möchten wir, vornehmlich unter Bezugnahme auf das Beispiel der Alltagsmobilität, erste Gedanken formulieren, wie es möglich wäre, „die positiven ökologischen Nebeneffekte der Corona-Krise zu verstetigen“ (Fuchs). Zentral ist dabei die Frage, wie ein ‚Exit‘ aus der Krise so gestaltet werden kann, dass sich neu etablierte, nachhaltige Praktiken auf individueller Ebene stabilisieren und neue Praktiken der Nicht-Nachhaltigkeit nicht zur Routine werden. In gewisser Weise gehen wir damit über die von Doris Fuchs aufgeworfene Frage hinaus und fragen ins Offene: Was könnte werden?
Corona und unser (nicht-)nachhaltiger Alltag
Der Lockdown in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie betrifft alle Lebensbereiche – von der Arbeit, über das Einkaufen, die Freizeitgestaltung bis hin zur Kinderbetreuung. Dies hat zur Folge, dass wir nicht mehr auf unsere bewährten Routinen zurückgreifen können. In einigen Branchen muss die Arbeit nun im bisher oft nicht vorhandenen Home-Office erledigt werden, Kinderbetreuung lastet exklusiv auf den Schultern der Eltern. Bewegung außerhalb des eigenen Hauses ist nur im Rahmen bestimmter Einschränkungen möglich. Eine zweifelsohne schwierige Umstellung des Alltags, aber doch zu bewältigen angesichts der Existenznot, die – wie Doris Fuchs mit ihrem Beitrag klarstellt – für Teile der Bevölkerung eben auch zur Krise gehört. Nach einigen Wochen der Reorganisation beginnen sich nun allmählich neue Routinen auszubilden. Für auftretende Probleme haben viele Menschen, aber sicherlich nicht alle, probate (Übergangs-) Lösungen gefunden. Einkäufe werden vermehrt via Internet erledigt, Treffen mit Freundinnen und Freunden finden virtuell statt, Spaziergänge werden zur beliebten Freizeitbeschäftigung und (Einkaufs-)Fahrten werden nicht mehr mit dem ÖPNV, sondern mit dem Pkw oder dem Fahrrad erledigt. Insbesondere unsere Fortbewegung hat sich stark verändert, indem wir viele Wege nicht mehr oder anders unternehmen oder sie durch Lieferverkehre substituieren. Neben dem Produktionsstopp in vielen Fabriken ist die eingeschränkte und veränderte Art der Fortbewegung der Hauptgrund für den beobachtbaren Rückgang der Schadstoffemissionen.
Aus sozialökologischer Perspektive lässt der zukünftige Gang der Dinge nach dem Lockdown sowohl hoffen als auch fürchten. Die Frage dabei ist, inwiefern die Corona-Krise Praktiken der Nicht-Nachhaltigkeit (dauerhaft) befeuert und etabliert oder diese eher zurückdrängt oder sogar unterbindet. Die Beantwortung der Frage ist eng mit der Thematik der Infrastrukturgestaltung und -veränderung verbunden. Es sind beispielsweise (digitale) Infrastrukturen notwendig, die das Arbeiten im Home-Office in entsprechenden Branchen dauerhaft ermöglichen. Es müssen aber auch kreative Lösungen gefunden werden, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch dann sicherstellen, wenn die Trennung in dafür vorgesehene Orte aufgehoben wird und sowohl Kinderbetreuung als auch Arbeit parallel zuhause stattfinden.
Die Krise zeigt: Das geht, aber bislang vor allem, weil es – zum Wohle des gesellschaftlichen Gutes Gesundheit – gehen muss und es derzeit keine Alternativen dazu gibt. Es geht, obwohl und gerade, weil vieles improvisiert ist. Dennoch, wenn bei aller Tragik der Krise dauerhafte ökologische Effekte daraus resultieren sollen, kann es ein „Weiter so“ wie vor der Krise nicht geben. Für eine Verstetigung positiver ökologischer Effekte ist nicht zuletzt eine entsprechende politische Rahmensetzung und die Schaffung einer verlässlichen Infrastruktur – gleichwohl ob digitale, verkehrs- oder soziale Infrastruktur – unerlässlich, die nachhaltige Praktiken stabilisiert und Praktiken der Nicht-Nachhaltigkeit möglichst unterbindet.
Krisen als kritische Zeitfenster des Wandels von Routinen
Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive bieten die bislang genannten Aspekte einige Anknüpfungspunkte, um die Veränderungen unserer Alltagsroutinen während des Lockdowns auch theoretisch zu beleuchten.
In den Momenten, in denen das Gewohnte, Vertraute und Alltägliche nicht mehr möglich ist, wird das sichtbar, was gewöhnlich unter der Oberfläche bleibt, was ungesagt vorausgesetzt wird. In den Momenten ihres Nicht-Funktionierens werden die zugrundeliegenden Infrastrukturen und Selbstverständlichkeiten der Gesellschaft sichtbar. Die erwerbstätige Bevölkerung, die Regierung, wir als Gesellschaft werden durch die Krise aus unserem Alltag gewissermaßen herausgerissen. Im Zuge sich überschlagender Ereignisse und zunehmender Einschränkungen wird der Alltag, werden die Routinen unseres Tuns zwangsweise infrage gestellt, unterbrochen, unmöglich gemacht und so letztendlich – um es mit einem Begriff aus der Ethnomethodologie auf den Punkt zu bringen – einem Krisenexperiment unterworfen. Wir alle standen und stehen vor sogenannten Handlungsblockaden, die unser gewohntes Tun als nicht mehr praktikabel, nicht mehr möglich oder gar nicht mehr legal erscheinen lassen. Dementsprechend findet eine Suche nach alternativen Handlungsweisen statt, ein Ausprobieren weiterer, neuer Möglichkeiten. Führt eine dieser Alternativen zum Erfolg, können sich potentiell neue Routinen ausbilden.
Diese Unterbrechung der Routinen birgt also ein großes Potential für eine nachhaltige Veränderung, aber eben auch die Gefahr der Etablierung und Verstetigung neuer, nicht-nachhaltiger Routinen. Indem sie aufzeigt, was sich bislang gewissermaßen „unter dem Radar“ befand, macht sie den Teil unseres Alltags einer Veränderung überhaupt erst zugänglich. Das implizite Wissen der Alltagspraktiken, das Know-How, das uns quasi intuitiv wissen lässt, wie die Dinge zu tun sind, wird nun für uns verfügbar. In Situationen, in denen das als gesetzt Wahrgenommene nicht mehr funktioniert, muss nach neuen Lösungen gesucht werden. In diesen Momenten haben neue Ansätze, neue Wege, neue Ideen die Chance, sich zu beweisen und so zur neuen Routine zu werden. Weil sich – aus der Not heraus – zeigt, dass es funktioniert, und das manchmal sogar besser als die altbewährten Wege und Methoden.
Dies wird am Beispiel der Mobilität deutlich. Menschen greifen für ihre Fortbewegung nun vermehrt auf das Fahrrad zurück, weil es ein probates Mittel des physical distancing im Rahmen der Fortbewegung darstellt. Allerdings bietet der private Pkw denselben Vorteil, weshalb dieser für viele ebenfalls wieder attraktiver als die als riskant empfundene Nutzung des ÖPNV erscheint. Fortbewegungsroutinen verändern sich also, jedoch aus sozialökologischer Perspektive nicht notwendigerweise zum Besseren. Im Hinblick auf Nachhaltigkeit wird es daher entscheidend sein, sich neu etablierende, nachhaltige Routinen zu stabilisieren und die Routinisierung nicht-nachhaltiger Praktiken zu vermeiden. Viele Städte und Kommunen beginnen daher vollkommen zurecht darüber nachzudenken, wie nun Fahrradmobilität dauerhaft zu Ungunsten automobiler Fortbewegung weiter an Attraktivität gewinnen kann. Gleiches muss auch für den ÖPNV gelten, der durch die Corona-Pandemie sicherlich einen Attraktivitätsverlust erlitten hatten. An diesem Punkt sind die Praktiken zweifelsohne nicht ohne den Raum und die (Infra-)Strukturen, in denen sie stattfinden, zu denken. Physical distancing und damit verbundene Praktiken benötigen mehr Raum, der bislang anderen Praktiken vorbehalten war. Im Moment der symbolhaften und doch physisch existenten ‚Leere‘ von Plätzen und Straßen ist also zu fragen, wie diese Räume als Infrastrukturen jetzt im Moment der Krise aber auch danach genutzt werden sollen: Für das Auto oder eher für FußgängerInnen oder das Fahrrad als Mittel zur Distanzüberwindung? An vielen Orten gehen Städte hier in diesen Tagen Schritte, die wohl vor einigen Wochen noch als Gedankenspiele einiger politischer AkteurInnen und gesellschaftlicher Interessensgruppen abgetan worden wären: Metropolen wie Brüssel, Bogotá, Köln oder Vancouver widmen in der Krise Raum um und stellen ihn veränderter Praxis – FußgängerInnen- und Fahrradmobilität – zur Verfügung.
Nach der Coronakrise bleibt vor der Klimakrise
Wie können wir die Krise so nutzen, um mittels der jetzt zu beschließenden Maßnahmen die Weichen dafür zu stellen, nach der Krise neue, nachhaltigere Praktiken zu etablieren und zu stabilisieren? Welche Konsum- und Mobilitätspraktiken werden also beispielsweise durch, zweifelsohne notwendige, Investitionsprogramme zum ‚Ankurbeln der Wirtschaft‘ gestützt?
An dieser Stelle scheint es unerlässlich darauf hinzuweisen, dass „die Krise“, die wir durchleben, nicht singulär ist: Es sind mehrere Krisen, die in unserer Wahrnehmung – und oft in unserer Reflexion – verschmelzen. Diese Konstellation ist nicht einzigartig und das Bild, das sich zeigt, ist in vielen anderen Kontexten ähnlich beobachtbar. Darüber hinaus sind nicht alle Bevölkerungsgruppen in gleichem Maße und in derselben Form von der Corona-Krise betroffen. Dies gilt es selbstverständlich zu berücksichtigen. Die Änderung von Praktiken, die wir im Vorherigen beschrieben haben, sind im Kontext einer Gesundheitskrise zu verstehen, die radikale Änderung von Alltagspraktiken legitimiert. Gleichzeitig rollt auch eine Wirtschaftskrise (neben einer Bildungskrise und weiteren mehr) auf uns zu, deren Logiken andere sind und die doch auch soziale Praxis reproduzieren oder aber verändern werden. Diese Krisen zusammenzudenken, kann helfen, die Pluralität der Krise als Chance für eine nachhaltige Transformation der Gesellschaft zu begreifen. Wiederum kann ein Beispiel aus dem Bereich der Mobilität herangezogen werden, um diese These zu illustrieren.
Erste Vorstöße und Lobbyaktivitäten legen nahe, dass es entscheidend sein wird, ob „Abwrackprämien“ auch für Autos mit Verbrenner-Motoren, wie nun von den Ministerpräsidenten der drei „Autoländer“ Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen gefordert wurden, wieder die Praxis der fossilen Automobilität reproduzieren. Oder kann auch hier ein Umdenken erreicht werden? Denn wenngleich Automobilunternehmen und ihre Interessensverbände ihre ökonomische Bedeutung für den Industriestandort aber auch für Forschung und Entwicklung mit Blick auf Zukunftstechnologien nicht zuletzt beim eigens initiierten „Autogipfel“ deutlich machen, so steckte die (deutsche) Automobilindustrie bereits vor dieser Krise in einer ganz eigenen. Der Anschluss an Zukunftstechnologien und die Auseinandersetzung mit neuen Mobilitätspraktiken galt schon lange vor Corona als “verschlafen“ bzw. zu zögerlich angegangen und die großen Konzerne zeigten sich sehr unterschiedlich in der Lage, auf globale Herausforderungen zu antworten und damit ihre Rolle in Transformationsprozessen zu finden. Diese Krise kann bedauert werden – sie zu lösen kann jedoch nicht bedeuten, bereits problematisch gewordene Mobilitätspraktiken weiter zu stabilisieren. Stattdessen muss die Bereitschaft bestehen, auch hier die Krise im besten Sinne zu nutzen – einen begonnenen Weg trotzdem weiterzugehen oder aber gerade deswegen auf ihn einzuschlagen. Es sind kreative und tragfähige Konzepte nötig, um Mobilitätspraktiken und -strukturen langfristig zu verändern. Diese gehen über die technische (Weiter-)Entwicklung von Fahrzeugen hinaus und werden nicht ohne die Industrie umzusetzen sein – Investitionen, die weniger direkt Automobilität als vielmehr neue Mobilitätskonzepte und Geschäftsmodelle unterstützen wären in dieser Weise sicherlich eine bedenkenswerte weitere Komponente eines Konjunkturpaketes.
Auch an anderen Stellen werden die Zielkonflikte deutlich, vor die uns die verschiedenen Krisen stellen: Das Heilmittel für die wirtschaftliche Krise, Konsum, steht potenziell Nachhaltigkeitszielen entgegen. So wird ebenso abzuwarten sein, wie der erst Ende des vergangenen Jahres von der neuen EU-Kommission ausgerufene „Green Deal“ die Corona-Krise übersteht, oder ob die darin eingeforderten Veränderungen nun zumindest aufgeschoben werden. Die Eingabe des europäischen Automobilbranchen-Verbandes an die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, mit der Bitte strengere Flottengrenzwerte vorerst auszusetzen, weisen in diese Richtung.
Was könnte werden?
Zu Beginn unseres Beitrages haben wir – anschließend an den Beitrag von Doris Fuchs – die Frage gestellt: Was könnte werden? Mit dieser Frage möchten wir dafür plädieren, die Krise(n), mit denen wir uns aktuell konfrontiert sehen, als ein kritisches Zeitfenster politischen Entscheidens zu begreifen. Die momentane Durchbrechung von Routinen und Praktiken ist eine Chance, diese auf den Prüfstand zu stellen und vor dem Hintergrund sozialökologischer Transformationsprozesse kritisch zu hinterfragen. Damit sich nachhaltigere Praktiken etablieren können, ist aber, so hoffen wir gezeigt zu haben, mehr als ein „Weiter so“ nötig. Vielmehr werden nachhaltige Praktiken unserer Ansicht nach erst dann „bleiben“ (und nicht-nachhaltige Praktiken allmählich verschwinden), wenn wir gleichzeitig politische, ökonomische, soziale und materielle Strukturen schaffen, die dies auch langfristig ermöglichen.
Tipps zum Weiterlesen
BBC (2020): Are we witnessing the death of the car? Online unter: https://www.bbc.com/future/article/20200429-are-we-witnessing-the-death-of-the-car
Mund, Cathrin (2020): #flattenthecurve: Die Heterotopie am Küchentisch. Blog sozmag. Online unter: https://soziologieblog.hypotheses.org/13539
Poliscanova, Julia (2020): Out with the old (engines), in with the new (zero-emission mobility). Blog Transport & Environment, 04/05/2020. Online unter: https://www.transportenvironment.org/newsroom/blog/out-old-engines-new-zero-emission-mobility
Zu den Autoren: Die Autoren des Beitrags sind Mitglieder der Nachwuchsforschungsgruppe „DynaMo“, die sich u.a. mit der nachhaltigen Gestaltung urbaner Mobilitätssysteme auseinandersetzt. Matthias Leger und Dr. Marco Sonnberger sind wissenschaftliche Mitarbeiter am Zentrum für Interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung (ZIRIUS) der Universität Stuttgart. Nils Stockmann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft der WWU Münster und assoziierter Mitarbeiter des ZINs.
Nachweis Titelbild: https://pixabay.com/