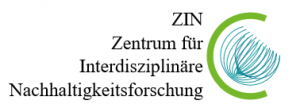Es wird wieder mal anstrengend vor dem Supermarktregal: Gemüse in Plastik eingeschweißt, ich sehe Bilder vor Augen von toten Vögeln denen Plastik aus dem Magen quillt. Wie viele Kilometer hat das Gemüse eigentlich zurückgelegt? Will ich eigentlich das Land unterstützen, aus dem das Produkt kommt? Eier aus Boden- oder Freilandhaltung, ich denke an den Fibronil-Skandal. Komme ich eigentlich um Massentierhaltung herum, wenn ich mich nicht vegan ernähre und trotzdem im Discounter einkaufen möchte? Label gibt es hier schließlich auch, aber Bio-Label oder Fair Trade-Label – ist das eigentlich die Entscheidung zwischen „der Natur“ und Bauern in Lateinamerika? Ich zahle zum Beispiel gerne 40 Cent mehr für einen Liter Milch, aber wen unterstütze ich damit eigentlich genau? Wer zwackt sich welchen Prozentsatz ab? Die drängendste Frage für mich ist jedoch gerade: bin ich eigentlich gezwungen, mit meiner Entscheidung Verantwortung zu übernehmen und mich damit gleichzeitig diesen ganzen Ansprüchen auszusetzen?
Wir erleben täglich, dass es bereits im Supermarkt um das Zulassen oder Wegschieben ethischer Fragestellungen geht. Ethik ist in diesem Sinne das kontinuierliche Nachdenken darüber, wie ich mich verhalten sollte und welche Entscheidungen ich treffe. Denn die Situation im Supermarkt lässt sich leicht auf andere Fragen übertragen: wie sollte ich reisen? Wie sollte ich wohnen? Wie sollte ich mich fortbewegen? Wie sollte ich mich mit Energie versorgen? Wie sollte ich mich kleiden? Diese Fragen berühren uns nicht nur als Einzelne. Wenn wir über die Art, wie wir leben, nachdenken, dann wissen wir, dass wir stets zu anderen in Beziehung stehen: natürlich zu unserer Familie, zum Freundeskreis, zum Kollegium, aber eben auch über unsere Konsumentscheidungen zu Menschen die uns fremd sind (z.B. Menschen die unsere Kleidung produzieren), Menschen die noch nicht geboren sind (z.B. durch Konsum umweltschädlicher Produkte), anderen Lebewesen (z.B. durch Konsum von Produkten aus Massentierhaltung), und ganzen Ökosystemen (z.B. durch Plastik in den Ozeanen). Unser Handeln hängt also häufig mit Beeinträchtigungen für andere zusammen: Wenn ein T-Shirt mehrfach um die Welt gereist ist und wir es im Laden für 2,95 EUR kaufen, dann ahnen viele von uns mindestens, dass da etwas nicht stimmen kann, auch wenn wir die direkte Beziehung zwischen unserem Konsum und den jeweiligen Produktionsbedingungen nicht beobachten können. Das heißt unsere Lebensweise und unser eigenes Urteil darüber, ob diese als gut oder schlecht zu bewerten ist, geht Hand in Hand. Mal ist uns dies bewusster, mal weniger bewusst, wenn wir abwägen, ob uns soziale oder ökologische, kurzfristige oder langfristige Ziele wichtiger sind. Doch wie lässt sich überhaupt, wenn wie oben beschrieben die Ansprüche an mein Verhalten ständig wachsen, auf Dauer ein verantwortliches Leben führen?
In einem kürzlich erschienenen ZEIT-Artikel mit dem Titel „Wie ich als Verbraucher beinahe den Verstand verlor“ beschreibt der Autor Marcus Rohwetter die Schwierigkeiten verantwortlichen Konsums: idealerweise sind Konsumakte moralisch gut, ökologisch nachhaltig, gegenüber anderen fair, machen gesund und bereiten obendrein noch Vergnügen. Doch dies ist alles andere als leicht. Um sich in diesem Dschungel unterschiedlicher Glaubenssätze und Wertvorstellungen zurechtzufinden und dem „Konsum-Burn-out“ vorzubeugen, hat der Autor für sich beschlossen, feste Routinen inmitten der Komplexität der Konsumwelt zu etablieren. Auch wenn beispielsweise der Umstieg auf Leitungswasser ein verhältnismäßig kleiner nachhaltiger Schritt sei, so sei dies für ihn trotzdem eine gute neue Routine, denn es ginge darum, sich „stets ein wenig besser zu verhalten als der Durchschnitt meiner Mitmenschen.“ Damit formuliert er nichts anderes als ein ethisches Prinzip. Und dieses scheint auf den ersten Blick plausibel zu sein, denn es ermöglicht ganz pragmatisch, sich sowohl gut zu fühlen als auch gleichzeitig nicht zu viel über jede individuelle Entscheidung nachdenken zu müssen. Der Autor verweist zudem auf die Verantwortung anderer: bevor er sich weiter über sein Verhalten Gedanken mache, müssten sich andere zunächst einmal seinem (wenn auch nur geringfügig) moralisch überlegenen Verhalten annähern.
In verschiedener Hinsicht ist eine solche Ethik jedoch problematisch. Sofern ich nur aus unterschiedlichen „Verhaltensangeboten“ auswählen muss, bedarf es keiner größeren moralischen Eigenleistung… das heißt ich muss mir keine Gedanken darüber machen, wer konkret von meiner Entscheidung betroffen ist. Was richtig und was falsch ist, ist bereits vorgegeben. Fair Trade Kaffee ist gut, konventioneller Kaffee ist schlecht. Viele dieser Angebote sind mit einem Preisschild versehen, das heißt ich kann ethisch besser handeln, wenn ich mehr Geld ausgebe. Also: kein Geld = keine Verantwortung? Dies über den Markt auszuhandeln hilft zudem dabei, eine Art Verantwortung zu leben, die nicht zu sehr einschränkt, die nicht emotional runterzieht, die man den eigenen Interessen entsprechend gestalten kann. Gleichzeitig entlastet dieses Engagement das schlechte Gewissen, das unser Verhalten in anderen Tätigkeitsfeldern verursacht: wir reisen per Billig-Flieger nach Mallorca, kaufen ein weiteres Paar neuer Schuhe, das wir eigentlich nicht brauchen – und spüren dabei, dass uns die uns ja oft bewussten ökologischen und sozialen Nebeneffekte dieser Dinge eigentlich widerstreben. Dieser Zustand, das unangenehme Aufeinanderprallen sich eigentlich ausschließender Gedanken und Wertvorstellungen, wird in der Sozialpsychologie als „kognitive Dissonanz“ bezeichnet. Weil diese Widersprüche sehr unangenehm und auf Dauer nicht auszuhalten sind, streben wir danach sie aufzulösen, indem wir unser „Ethisch-sein-Wollen“ (die Ansprüche an unser Handeln) mit unserem „Nicht-ethischen-Handeln“ (unseren unreflektierten Bedürfnissen) ausbalancieren. Damit dies gelingt, rechtfertigen wir unser Tun vor uns selbst: „das mit der Flugreise passt schon, ich fahre ja sonst nur Fahrrad. Neue Schuhe kann ich mir (mal) gönnen, ich verzichte ja bereits durch meine vegetarische Ernährung. Und das ist auch ohnehin nicht so problematisch, weil ich mich ja bereits besser verhalte als so viele andere.“ Oftmals ist das Problem also gar nicht, dass wir zu wenig Wissen über die Zusammenhänge haben, sondern dass wir ganz einfach nicht zu viel darüber wissen wollen.
Wenn einfache Alltagsroutinen also den Effekt haben können, dass wir unsere Verantwortung teilweise ausblenden, wie könnte dann eine Ethik aussehen, die mehr Verantwortung zulässt? Der Philosoph Peter Singer entwickelte in den 1970er Jahren ein mittlerweile bekannt gewordenes Gedankenexperiment. Wenn ich an einem seichten Teich vorbeigehe und erblicke wie ein Kind ertrinkt, empfinde ich es als meine Pflicht, in den Teich zu waten und das Kind herauszuziehen. Dies bedeutet zwar, dass meine Schuhe und meine Kleider mit Schlamm bedeckt werden, doch dies wäre im Verhältnis bedeutungslos, da das Leben des Kindes schwerer wiegt. Das für Singer zugrundeliegende moralische Prinzip beschreibt, dass wenn es in unserer Macht liegt, etwas moralisch Schlechtes zu verhindern, ohne dabei irgendetwas von vergleichbarem moralischen Status aufgeben zu müssen, dann sind wir verpflichtet dies zu tun. Und die allermeisten Menschen würden diesem Prinzip auf Anhieb zustimmen: „natürlich, vergiss die Schuhe, ich würde selbstverständlich das Kind retten“. An dieser Stelle weist der Philosoph darauf hin, dass Organisationen wie UNICEF oder Oxfam mit dem Geld für ein paar neue Schuhe das Leben eines Kindes, vermutlich mehrerer Kinder, die ansonsten keinen Zugang zu medizinischer Versorgung hätten, retten könnten. Denn Entscheidungen, wofür wir Geld ausgeben, seien gleichzeitig auch Entscheidungen, wofür wir unser Geld gerade nicht ausgeben. Es lässt sich schwer bestreiten, dass das Spenden eines Teils des eigenen Einkommens leicht dazu eingesetzt werden kann, menschliches Leid zu lindern. Aber heißt das, dass wir jetzt unser Geld besser spenden sollten, als „bessere“ Produkte zu kaufen? Gibt es nicht Parallelen zu Konsumentscheidungen, indem wir auch über Spenden unser Gewissen entlasten, insgesamt so weiter leben können wie bisher und scheinbar nur dann Verantwortung übernehmen können, wenn wir Geld abgeben? Und sind die Ansprüche an uns nicht ungleich höher, wenn wir jede finanzielle Ausgabe gegen menschliches Leid aufwiegen sollen?
Was bleibt also übrig in Bezug auf unsere Verantwortung in einer bedrohten Welt, wenn feste Routinen und ethische Prinzipien keine einfachen Lösungen versprechen? Meine Antwort scheint im ersten Moment nicht sonderlich befriedigend zu sein. Vermutlich werden wir niemals ein festes moralisches Prinzip, eine stabile Verhaltensroutine finden, welche ein für alle Mal unsere Verantwortung gegenüber der Welt abschließend festlegen könnte. Doch mit dieser Erkenntnis gehen viele der Rechtfertigungen verloren, die uns erlauben würden, irgendwann Genugtuung zu verspüren, uns zurückzulehnen und zu sagen: „ich habe genug getan“. Gerade indem wir lernen, mit der Unmöglichkeit zu leben, all den unterschiedlichen Ansprüchen des Alltags gerecht werden zu können, verstehen wir vielleicht, dass sich Verantwortung weder individualisieren, noch messen oder beziffern lässt. Und daraus lässt sich Kraft schöpfen. Verantwortung heißt vor allem: antwortbereit zu sein und uns nicht davor zu drücken, aufrichtige Antworten auf wichtige Fragen zu geben. Darin sind wir nicht alleine, denn wir alle tragen Verantwortung für andere, und andere tragen Verantwortung für uns: Familie, Freunde und sogar Fremde. Schlechte Arbeitsbedingungen und ökologische Probleme, wo auch immer auf der Welt, lassen sich nicht auf unsere Einzelhandlungen zurückführen, denn sie sind in aller Regel systemisch. Ich oder du am Bildschirm, wir können das alleine nicht beheben, und wir können uns auch nicht mit einer Unzahl kleinerer moralischer Abwägungen im Alltag überlasten. Das heißt im Umkehrschluss jedoch nicht, dass wir von unserer Verantwortung freigesprochen würden, denn wir können insbesondere auch kollektiv etwas an den Verhältnissen ändern, durch gemeinsames Diskutieren und Handeln. Und diese Haltung sollte uns verantwortliche Gelassenheit vor dem Supermarktregal lehren: die Summe meiner Kaufentscheidungen wird eine bedrohte Welt nicht vor dem Kollaps bewahren. Dafür brauchen wir die grundlegendere Erkenntnis, dass unsere Sorgen sowie die Sorgen anderer teilbar sind und den Willen, kollektive, aufrichtige Antworten auf die wichtigen Fragen unserer Zeit zu formulieren.
Zum Weiterlesen:
Rohwetter, Marcus (2017): Wie ich als Verbraucher beinahe den Verstand verlor. In Die Zeit, Nr. 42/2017, S. 23-24.
Singer, Peter (1972): Famine, Affluence, and Morality. In Philosophy & Public Affairs, Vol. 1 (3), S. 229-243.
Titelbild: Pixabay.com