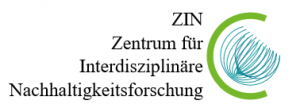Ob bio, fair, regional, lokal, saisonal oder unverpackt, beim alltäglichen Lebensmitteleinkauf scheint es, dass die Öffentlichkeit wissen möchte, unter welchen Bedingungen und wo die gekauften Lebensmittel hergestellt werden. Die Frage, was „gutes Essen“ ausmacht, beschränkt sich schon lange nicht mehr auf die Kriterien des Geschmacks, sondern auf die moralischen Kriterien einer „guten Produktion“ und eines „guten Handels“. Getreu dem Motto „Politik beginnt bei dem/der VerbraucherIn“ wird an das Verantwortungsbewusstsein der KonsumentInnenenfigur appelliert. Dabei können die moralischen Beweggründe sehr unterschiedlich sein, wenn KonsumentInnen ein bestimmtes Produkt einem anderen vorziehen. Beispielsweise könnte eine derartige Kaufentscheidung dem Kriterium der energiesparsamen Transportwege, der Solidarität mit den ProduzentInnen aus der eigenen Region oder die Unterstützung einer Alternative zur industriellen Massenproduktion zugrunde liegen. Im Einzelnen werden regionalen Lebensmitteln häufig positive Beiträge zum Klimaschutz, zur Erhaltung der Biodiversität und zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung nachgesagt. Das Label „Regionalität“ scheint damit die zentralen Forderungen an die Lebensmittelqualität zu erfüllen, indem es für viele KonsumentInnen gleichbedeutend zu sein scheint mit Transparenz, Herkunftsnachweis und Rückverfolgbarkeit. Doch kann tatsächlich die räumlich definierte Herkunft eines Lebensmittels Garant für dessen Qualität und die Einhaltung der moralischen Werte der KonsumentInnen sein? Inwiefern kann also das Wissen über das „wo“ Rückschlüsse auf das „wie“ ermöglichen?
Welcher Zusammenhang zwischen Moral und Herkunft?
Aussagen wie „Ich esse zwar ab und zu Fleisch, aber nur wenn ich auch weiß, wo es herkommt.“ zeigen, dass beim alltäglichen Konsum der Verweis auf die Herkunft entscheidend ist. Doch was genau meint Herkunft? Klassischerweise bezieht sich die Herkunft eines Lebensmittels auf die Orte der Produktion, der Vermarktung und des Konsums. Gerade im Kontext der „Responsibilisierung“ westlicher KonsumentInnen jedoch, meint Herkunft vor allem auch die Menschen und Begebenheiten, die an Herstellung, Vermarktung und Kauf eines Produkts beteiligt sind. In dieser Hinsicht ist ein Trend zu beobachten, dass die Frage welches Produkt aus moralischen Gründen einem anderen Erzeugnis vorzuziehen sei, eine vorrangige Rolle bei der Bewertung des Lebensmittels spielt. Vor diesem Hintergrund werden individuelle Essgewohnheiten einerseits und das Problem der Klimagerechtigkeit andererseits in einen unmittelbaren Zusammenhang gerückt. Jede KonsumentInnenentscheidung entfaltet damit eine konkrete Wirkung an anderen Orten. Dies führt, wie sehr oft, zu Interessenskonflikten. Häufig liegt für KonsumentInnen ein moralisches Dilemma vor, wenn sie sich etwa entscheiden müssen zwischen einer „guten“ und gesunden Ernährung einerseits oder einem geringen Energieaufwand andererseits, wie dies beispielsweise auch der Fall beim Kauf von biologisch hergestellten Erzeugnissen sein kann. Sollte man das biologisch-fair hergestellte Produkt aus dem weit entfernten Ausland dem „heimischen“ bzw. „regionalen“ Produkt mit einem dafür energiesparsameren Vertriebsweg vorziehen? Welches moralische Kriterium sollte der/die KonsumentIn priorisieren? Moralische Kriterien können dabei sehr vielfältig sein: ökologische Arbeitsbedingungen für Beschäftigte in diesem Sektor oder auch der Erhalt von kulturell wertvollen Produktionsstrukturen etc.
Warum liegt das Gute (nicht immer) so nah?
„Das Gute liegt so nah“ – gerade derartige Slogans bringen die Moralisierung der räumlichen Nähe zum Ausdruck. Doch welche Schwierigkeiten birgt die moralische Bewertung dieser Kategorie in sich? Ein derartiger Regionalitätsdiskurs schafft einen nicht nur missverständlichen, sondern schlicht und einfach falschen Dualismus, bei dem das „Nahe“ als das „Gute“ und das „Ferne“ als das „Schlechte“ dargestellt werden. Viele KonsumentInnen bevorzugen Produkte, die nicht tausende von Kilometern transportiert werden müssen, bevor sie im Kochtopf landen. Dabei schenken die KundInnen Begriffen wie „Regionalität“ und „Lokalität“ zunehmende Beachtung. Doch was heißt „aus der Region“ genau? Hier kommt schon der erste Kritikpunkt zum Ausdruck, denn die Definition von „Region“ bleibt den freiwillig partizipierenden LizenznehmerInnen (den Handelsketten) überlassen. Regionalfenster e. V. definiert folgende Rahmenbedingungen für das Label „Regional“ : „Die Region muss für den Rohwarenbezug eindeutig und nachprüfbar benannt werden (z.B. Landkreis, Bundesland oder Angabe eines Radius in Kilometern) und kleiner als die Bundesrepublik Deutschland sein, sie kann jedoch Staats- oder Ländergrenzen überschreiten (z.B. Getreide aus der Eifel oder 100 Kilometer um Aachen)“ (Regionalfenster e.V. 2015). Anhand dieser Darstellung lässt sich erkennen, dass es sich bei dem Etikett „regional“ um kein zuverlässiges Kaufkriterium handelt, da weder eine einheitliche noch verbindliche Definition festgelegt ist. Der Begriff der „Region“ ist daher sehr weit ausdehnbar und ermöglicht so den HerstellerInnen, diesen frei und vor allem zum Vorteil ihrer Marketingzwecke auszulegen. Je nachdem wie der Radius der jeweiligen Region von den Handelsketten bestimmt wird, fallen die Transportwege entsprechend weiter aus. Dies ist insbesondere deshalb so problematisch, da der Regionalitätsdiskurs mit einer räumlichen Nähe der Produkte wirbt, die nicht zwingend eingehalten werden muss. Viel wirkungsvoller jedoch ist in diesem Kontext, der symbolische Charakter dieses Labels, indem HerstellerInnen den KonsumentInnen eine vermeintliche Nähe zu ihrer „zugehörigen“ bzw. „heimischen“ Region vortäuschen.
„Regional“ – und doch nicht immer sinnvoll?
Die ursprüngliche Grundidee „regionaler Produkte“, eine Alternative zur industriellen Produktionslogik zu bieten, ist schon lange keine Priorität mehr. Es handelt sich vielmehr um kommerzielle Vermarktungsstrategien des Lebensmittelhandels zur gezielten Beeinflussung der KonsumentInnen. Das Label der „regionalen Herkunft“ ist also, unabhängig von Produktionsbedingungen, per se zu einem moralischen Gütesiegel geworden. Die Qualität eines Lebensmittels lediglich an der Kilometerdistanz zwischen ErzeugerInnen und VerbraucherInnen festzumachen ist nicht nur wenig überzeugend, sondern auch problematisch. Wie der spezialisierte Geograph im Bereich der Agro-Food Studies, Ulrich Ermann (2015), betont, ist der Energieverbrauch beim Transport nicht auf die Kilometerdistanz zu reduzieren. Insbesondere durch logistische Skaleneffekte großer Produktions- und Distributionseinheiten über weitere Distanzen können einzelne Produkte auch energiesparsamer transportiert werden. Zudem werden manche Produkte zwar regional hergestellt, zur Weiterverarbeitung wiederum legen sie weite Transportwege zurück.
Fazit
Die „Heimatprodukte“ mit denen die meisten Supermarktketten werben, stellen für die KonsumentInnen oft wider Erwarten keine Alternative zur industriellen Produktion dar. Durch die häufig nur vorgetäuschte räumliche Nähe zum zugehörigen Ort einer VerbraucherIn, schaffen derartige Etikettierungen ein irreführendes „Vertrauensverhältnis“ zwischen der KonsumentIn und ihrem Produkt. So wird „räumlich nah“ hergestellten Erzeugnissen ein moralischer Wert zugeschrieben, wie beispielsweise die Solidarität und Sympathie mit den ProduzentInnen und BäuerInnen aus einer (ungenau definierten) Region. In diesem Zusammenhang, wird an die regionsbezogene Konsummoral appelliert, wodurch sich die KonsumentInnen für die Entwicklung einer Region verantwortlich fühlen sollen, die sie intuitiv jedoch häufig woanders verorten bzw. anders eingrenzen als der oder die HerstellerIn selbst.
Abschließend lässt sich sagen, dass das alleinige Wissen über die Herkunft eines Lebensmittels, nicht ausreichend ist, um dieses moralisch bewerten zu können. Das entscheidende Kaufkriterium ist hier die Frage nach dem „wie“ der Produktionsbedingungen. Der Kennzeichnung „Regionaler Anbau“ können die VerbraucherInnen also nicht immer vertrauen. Denn sie ist oft ungenau: Wo fängt die Region an, wo hört sie auf? Eine einheitliche Regelung für die Bezeichnung „Regionaler Anbau“ gibt es nicht, deshalb sind hier eine prüfende Skepsis seitens der VerbraucherInnen oder auch explizite Forderungen für eine Reform des Labels „regional“ angebracht. Bessere und verpflichtende gesetzliche Regelungen, sowie das Einführen von Kontrollen sollten ein transparenteres Einkaufen ermöglichen, um Handelsketten davon abzuhalten falsche, nicht überprüfbare und ambivalente Regionalangaben ohne nachvollziehbare Kriterien zu vermarkten.
Zum Weiterlesen:
BUND. Mit Brief und (Bio-)Siegel: Welche Kennzeichnung von Lebensmitteln ist empfehlenswert?https://www.bund.net/themen/massentierhaltung/haltungskennzeichnung/biosiegel/, 27.03.2020.
Ermann, U. (2015): „Wissen, wo’s herkommt“ – Geographien des guten Essens, der Transparenz und der Moral der Herkunft von Lebensmitteln, in: Strüver, Anke (Hrsg.):Geographien der Ernährung – Zwischen Nachhaltigkeit, Unsicherheit und Verantwortung. Hamburg 2015 (Hamburger Symposium Geographie, Band 7): 77-94.
Grunwald, A. (2018): Warum Konsumentenverantwortung allein die Umwelt nicht rettet. Ein Beispiel fehllaufender Responsibilisierung. In: Henkel, A. et al. (Hg.): Reflexive Responsibilisierung. Verantwortung für nachhaltige Entwicklung. Bielefeld: transcript. S. 422–436.
Idies, Y. (2018). Ernährungsgerechtigkeit durch souveränen Konsum? Individuelle Bedürfnisse als ökonomische Praxis, Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie, 62(3-4), 246-259. doi: https://doi.org/10.1515/zfw-2017-0040
Kallhoff, A. (2015): Klimagerechtigkeit und Klimaethik. De Gruyter.
Kreutzberger, S. (2012): Die Öko-Lüge: Wie Sie den grünen Etikettenschwindel durchschauen, Berlin, Ullstein. Regionalfenster e.V. (2015): Kriterien für „regionale Herkunft“ auf der Homepage „Regionalfenster“, http://www.regionalfenster.de/kriterien.html. 27.03.2020.
Rosol, M., & Strüver, A. (2018). (Wirtschafts-)Geographien des Essens: transformatives Wirtschaften und alternative Ernährungspraktiken, Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie, 62(34), 169-173. doi: https://doi.org/10.1515/zfw-2018-0005
Zu der Autorin: Claudine Gerard studiert an der WWU Münster und dem Sciences Po Lille den Doppeldiplomstudiengang „Internationale und Europäische Governance“ mit dem Schwerpunkt Konflikte und Entwicklung. Durch unterschiedliche Praktika und Forschungsarbeiten ist ihr Schwerpunkt im Forschungsgebiet der nachhaltigen Entwicklung, insbesondere in den Politikfeldern der Agro-Food Studies, der Umweltpolitik sowie der Politischen Ökonomie verankert.
Nachweis Nachweis Titelbild: https://pixabay.com/