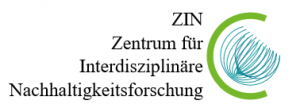Die aktuelle Diskussion um ein Tempolimit auf Autobahnen wirft einmal wieder die Frage auf, inwiefern Regierungen in die persönlichen Entscheidungsprozesse des Einzelnen eingreifen dürfen oder sollen, um nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Schon in der Vergangenheit haben staatliche Verbote im Umweltbereich oft zu Protesten geführt.
Verbote als Quelle von Protest
Mit Inkrafttreten der Ökodesign-Richtlinie für Leuchtmittel der Europäischen Union im September 2009 wurde im Interesse der Energieeffizienz von Leuchtmitteln EU-weit ein Verbot des Verkaufs herkömmlicher Glühbirnen durchgesetzt. Bereits direkt nach der Ankündigung der Richtlinie, wurden (u.a. von EU-Gegner*innen) Stimmen laut, dass ein Verbot eines solchen alltäglichen Gebrauchsgegenstandes die Freiheit der EU-Bürger*innen beschneide und es kam zu Hamsterkäufen herkömmlicher Glühbirnen. Ebenso hat das im Interesse der Luftreinheit in mehreren deutschen Städten erwogene und zum Teil durchgesetzte Dieselverbot jüngst Gemüter erregt und bei Dieselfahrzeugbesitzer*innen Fragen darüber aufgeworfen, ob und wie sie ihr Fahrzeug in Zukunft weiter nutzen können.
Nicht nur diese beiden Beispiele, sondern auch erhöhte Strompreise durch erneuerbare Energien oder die Arbeitslosigkeit von Kohlearbeiter*innen zeigen: Umweltpolitische Maßnahmen sind oft mit Kosten für die Bevölkerung verbunden. Es ist daher kaum verwunderlich, dass solche Maßnahmen häufig eine Welle der Kritik auslösen. Auch in Frankreich hat der Gelbwestenprotest ja mit ähnlichen Grundlagen begonnen. Wenn aber bei den Bürger*innen das Gefühl aufkommt, die persönliche Freiheit würde zu sehr beschnitten, kann das wiederum zu Widerstand und Ablehnung nicht nur der Maßnahmen, sondern auch der Regierung oder der Umweltpolitik als solches führen. Fraglich ist daher, wie diese Wahrnehmung entsteht oder, viel wichtiger, wie sie vermieden werden kann.
Lieber Anreize und Informationen?
Die einfachste Antwort wäre sicherlich, auf Verbote zu verzichten und stattdessen mit (finanziellen) Anreizen zu arbeiten oder auf Informationskampagnen zu setzen. Genau das ist ja auch seit den 1980er Jahren verstärkt in der Umweltpolitik passiert, weil Politiker*innen immer weniger bereit waren, die politischen Kosten unpopulärer Entscheidungen zu tragen. Allerdings haben die vergangenen Dekaden eben auch gezeigt, dass Informationskampagnen oft nur eine sehr beschränkte Wirkung haben. Insgesamt erhalten die Bürger*innen heute vielleicht eher zu viel als zu wenig an Informationen (s. das „Kleingedruckte“ auf Produkten) oder auch nicht die wirklich relevanten (auf welchem Kleidungsstück stehen die reellen Bedingungen der Herstellung?). Finanzielle Anreize wiederum werden von der Politik in umweltpolitischen Kontexten meist in einer Höhe gesetzt, in der sie wenig Wirksamkeit entfalten. Finanzielle Anreize in wirksamer Höhe erfahren nämlich den gleichen politischen Widerstand wie Verbote. Insofern stellt ein Ausweichen auf andere politische Instrumente auch keine Lösung hinsichtlich des Dilemmas staatlicher Begrenzung individueller Freiheit im Interesse umweltpolitischer (oder auch sozialpolitischer) Ziele dar. Effektive Umweltpolitik wird immer mit einem Mix von Instrumenten arbeiten müssen.
Die Verfolgung gemeinsamer Ziele
Regierung haben den Auftrag, das Gemeinwohl ihrer Gesellschaften zu verfolgen. Dazu können sie die Freiheit der einzelnen Bürger*innen beschränken und tun das auch, nicht erst seit der Entwicklung der Umweltpolitik. Aber auch gerade im Bereich der Umweltpolitik können und müssen sie Einfluss u.a. auf ihre Bevölkerung nehmen und diese durch politische Maßnahmen zu einem nachhaltigeren Lebensstil bewegen, wenn Fortschritte in der lokalen, regionalen oder globalen Umweltqualität erzielt werden sollen. Nach allem was wir heute wissen, kann eine Regierung ihrer Verantwortung zum Beispiel in Sachen Klimaschutz nicht nachkommen, ohne dabei Konsummöglichkeiten der Bürger*innen einzuschränken. (Gleichzeitig müssen natürlich auch ständig unterschiedliche Gemeinwohlinteressen, z.B. ökologische und soziale abgewogen bzw. in Einklang gebracht werden).
Wenn aber die Bevölkerung nicht versteht, aus welchem Grund die Regierung zum Beispiel ein Verbot auf ein liebgewonnenes Produkt auferlegt, kann ein Gefühl der Unterrepräsentation entstehen. In diesem Kontext stellen vor allem unzureichende Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Beschränkungen der individuellen Freiheit deren Akzeptanz vor große Hürden. Hier ist eine transparente Kommunikation der Notwendigkeit und Wirkung von Maßnahmen, wie auch eine als angemessen empfundene Verteilung der Verantwortung und Kosten (im Kontext mit dem Dieselskandal zum Beispiel auch auf die Autoindustrie) unerlässlich.
Letztendlich muss die Bevölkerung den Beitrag erkennen können, der durch die individuelle Einschränkung zur Erreichung des gemeinsamen Ziel geleistet wird. Das wiederum setzt ein Verständnis und einen grundsätzlichen Konsens hinsichtlich des Zieles voraus, wofür u.a. Bildung eine wichtige Voraussetzung ist. Vor allem aber ist die tatsächliche Benennung eines erstrebenswerten Zieles zentral, eines Nutzens in der Form der letztendlichen Verbesserung von Lebensqualität in der Gemeinschaft.