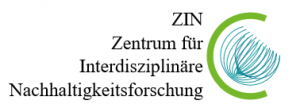Doris Fuchs
Ottmar Edenhofer hat letzte Woche den Deutschen Umweltpreis verliehen bekommen, insbesondere auch für seinen Vorschlag zur CO2-Bepreisung, einem wesentlichen Element des 2019 verabschiedeten Klimapakets der Bundesregierung. Nun ist die Idee einer CO2-Bepreisung gar nicht so neu. Tatsächlich war auch der europäische Emissionshandel schon als Preismechanismus zur Reduzierung von CO2-Emissionen gedacht, und dem ganzen Ansatz liegen wirtschaftstheoretische Überlegungen zugrunde, die wiederum der Brite Arthur Cecil Pigou bereits 1920 veröffentlichte (hier eine kurze Erläuterung der Pigou-Steuer). Den Unterschied zum Emissionshandel machte allerdings dieses Mal die konkrete Festsetzung des Preises durch die Politik. Gleichzeitig führte diese Festlegung umgehend zu kontroversen Debatten, ob der Preis zu hoch oder zu niedrig sei; zu hoch für die ärmeren Teile der Bevölkerung bzw. zu niedrig, um die Klimaziele tatsächlich zu erreichen.
Was also ist der „wahre Preis“ des Wandels, der Preis, den wir zahlen müssten, wenn wir eine tatsächliche Veränderung in Produktions- und Konsummustern erzeugen wollten, die die Ziele des Pariser Klimaabkommens, die Erderwärmung auf 1,5° zu begrenzen, ernst nimmt? Kann man so einen „wahren Preis“ bestimmen – und falls ja, wollen wir das wirklich tun?
Was ist der „wahre Preis“?
Tatsächlich werden auch KlimaforscherInnen sich nie ganz einig sein, was der 100% richtige Preis für eine Tonne CO2 ist. Klimamodelle unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Berechnung von Dynamiken – und von diesen Dynamiken bis zur Identifikation von etwaigen Preisen ist es ein weiter Weg, u.a. weil auf diesem Weg zusätzlich die zu erwartenden Reaktionen von wirtschaftlichen Akteuren sowie von Konsumentinnen und Konsumenten auf Preisveränderungen geschätzt werden müssen. Insofern geht es beim „wahren Preis“ vielmehr um Schätzungen und Tendenzen als um die Frage von ein paar Cent mehr oder weniger für eine Tonne CO2.
Trotz aller Komplexität kommen wir aber natürlich nicht darum herum, den Preis von seiner erwünschten Wirkung her zu bestimmen. Mit anderen Worten: wir müssen uns als erstes die Frage stellen, welchen Wandel brauchen wir eigentlich? Erst danach macht es Sinn zu entscheiden, welcher Preis für eine Tonne CO2-Emissionen tatsächlich den Weg dorthin bereiten wird.
Welchen Wandel brauchen wir?
Hier ist die grundsätzliche Antwort wiederum gar nicht so schwer. Wenn wir den Forschungsergebnissen der bei weitem überwiegenden Mehrheit der KlimaforscherInnen in der Welt Rechnung tragen, dann brauchen wir einen fundamentalen Wandel, und wir brauchen ihn jetzt: Permafrostböden in Sibirien tauen. Polares Eis schmilzt mit unkalkulierbaren Risiken sowohl für die fruchtbarsten Regionen der Ozeane wie für ihre Strömungen. Selbst der Regenwald erlebt Dürreperioden, und die aufgrund ihrer Temperaturen von Menschen nicht bewohnbaren Regionen der Erde breiten sich aus. Das sind nur einige der deutlichen Zeichen der Zeit.
Insofern wird nachvollziehbar, dass die Kritik vieler Klimaforscherinnen und -forscher am Klimapaket festgesetzten Preis für CO2-Emissionen darauf fokussierte, dass dieser zu niedrig sein könnte. Eine zu niedrige Preissetzung würde uns nicht erlauben, das Ruder wirklich herumzureißen. Für das Klimapaket war zunächst ein Einstiegspreis von 10 Euro pro Tonne CO2 angesetzt, im Vermittlungsausschuss einigten sich Bund und Länder letztendlich auf 25 Euro pro Tonne. Damit die CO2-Bepreisung jedoch überhaupt eine wirtschaftliche Lenkungswirkung entwickeln kann, fordern ForscherInnen und NGOs einen Einstiegspreis zwischen 35 und 50 Euro. Die Gefahr einer zu niedrigen Preissetzung ist einerseits, dass das anvisierte Klimaziel nicht erreicht wird, andererseits suggeriert die Bepreisung uns fälschlicherweise gleichzeitig, dass das Problem bearbeitet wird. Zu niedrige Preissetzungen sind also eher Symbolpolitik als lösungsorientiertes Handeln. So war es im Übrigen mit dem europäischen Emissionshandel, in dem die Preise für CO2-Emissionen aufgrund des Marktdesigns viel zu niedrig waren, um die gewünschte Wirkung zu entfalten. Und nach zwanzig Jahren Symbolpolitik überrascht es vielleicht auch nicht, dass Menschen genervt sind, wenn sie den Eindruck haben, dass jetzt die hundertste politische Intervention versucht, den Klimawandel zu bekämpfen, wenn sie doch gefühlt schon seit Jahren mit entsprechenden Maßnahmen „belastet“ werden. Deren Wirkungslosigkeit mag vielleicht die Wissenschaft aufzeigen, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist eine andere.
Als Fazit zum wahren Preis des Wandels kann man also sagen, dass es nicht den einen wahren Preis gibt, sondern dieser vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnisse und Debatten politisch festgesetzt werden muss (natürlich mit dem Wissen der Notwendigkeit von Adjustierungsmöglichkeiten im Laufe der Zeit). Zu niedrige Preise helfen dabei nicht und sind im Zweifel sogar politisch gefährlich. Insbesondere aufgrund des Ausmaßes und der Dringlichkeit des Wandels muss beim CO2-Preis leider „geklotzt“ und nicht „gekleckert“ werden – was uns zur Frage führt: ob und unter welchen Bedingungen wollen wir solche Preise überhaupt?
Wollen wir einen (hohen) Preis auf CO2-Emissionen setzen?
Die Frage, ob wir die Natur überhaupt bepreisen und damit zur Ware machen dürfen, ist eine grundsätzliche Frage, die umweltwissenschaftliche und -politische Debatten durchaus lange beschäftigt hat. Hat die Natur nicht intrinsische Werte, die nicht bepreist werden können oder sollten? Man könnte meinen, dass die Politik diese Debatte faktisch nun beendet hat: ein Preis wurde festgelegt. Tatsächlich bepreisen wir die Natur in unserer Marktwirtschaft schon viel länger, nur dass wir die längste Zeit quasi mit einem Preis von 0 Euro, Dollar o. Ä. gearbeitet haben. So ließ sich die Natur ausbeuten, ohne die entsprechenden Kosten zu übernehmen.
Nichtsdestotrotz ist die Frage, welche Aspekte des gesellschaftlichen Lebens wir dem Markt überlassen bzw. über Preise regeln wollen natürlich eine sehr wichtige. Die Frage, wer sich dann noch was leisten kann, ist gesellschaftspolitisch zentral – nicht erst vor dem Hintergrund der noch nicht absehbaren wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Gleichzeitig suggeriert die Argumentation, dass wir klimaschädliche Produktions- und Konsumentscheidungen nicht teuer machen sollten, weil das die ärmeren Teile der Gesellschaft besonders treffen würde, ein falsches Dilemma. Die Entscheidung kann vor dem Hintergrund des notwendigen Wandels nicht sein, ob Klimazerstörung teuer wird oder nicht, sondern muss sein, wie die Kosten verteilt werden. Deshalb muss umweltpolitische Preispolitik immer mit entsprechenden sozialpolitischen Maßnahmen einhergehen. Der Markt als Mechanismus fördert bestenfalls Effizienz im Wirtschaften (und auch das nur, wenn ziemlich viele und schwierige Bedingungen erfüllt sind). Er dient aus sich heraus nicht der Förderung sozialer Gerechtigkeit. Hier sind politische Weichenstellungen zwingend erforderlich.
Ein weiteres Fazit muss daher lauten, dass eine Bepreisung von CO2 zwar gebraucht wird – wenn wir nicht das bisher nahezu kostenlose Vorantreiben des Klimawandels weiter zulassen wollen. Aber solch eine Bepreisung muss zwingend verbunden werden mit einer Förderung sozialer Gerechtigkeit.
Mehr als Preise!
Insofern bleibt die Frage, welche Position Preise im klimapolitischen Instrumentenmix spielen sollten. Sie können sicherlich eine wichtige Steuerungsfunktion für Produktion und Konsum entfalten. Gleichzeitig ist die Gesellschaft natürlich mehr als ein Markt. Wir sind nicht nur Konsumentinnen und Konsumenten, sondern auch Bürgerinnen und Bürger. Angesichts dessen würde eine klimapolitische Steuerung nur über Preise zu kurz greifen, insbesondere wenn man wiederum an die Höhe der notwendigen Preise denkt. Notwendig ist hier zusätzlich ein gesellschaftlicher Dialog über unsere Ziele. Hilfreich wäre es, wenn wir uns nicht nur über das verständigen, was wir vermeiden müssen im Sinne des Klimawandels, sondern vor allem auch darüber, was wir an Positivem erreichen wollen. Konkret bedeutet das darüber zu reden, was Lebensqualität für uns bedeutet und wie wir es in Anbetracht der ökologischen Krisen trotzdem oder erst recht schaffen können, gemeinsam allen Menschen, die jetzt und in Zukunft leben (werden), ein gutes Leben zu ermöglichen.
Zu der Autorin:
Prof.‘in Doris Fuchs ist Inhaberin des Lehrstuhls für „Internationale Beziehungen & Nachhaltige Entwicklung“ sowie Sprecherin des Zentrums für Interdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung der Universität Münster. Weitere Informationen zu ihrer Forschungstätigkeiten erfahrt Ihr hier.
Bildquelle: Pixabay (enthält eigene Abänderung des Originals)