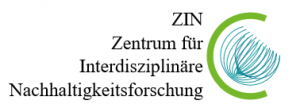Marianne Heimbach-Steins
Sorge ist Arbeit. Auch wenn sie nicht erwerbsförmig geleistet wird, verdient sie Anerkennung als Arbeit. Und: Arbeit braucht Sorge, weil gutes Leben und gutes Arbeiten ohne eine Sorgekultur nicht möglich sind. Das Verhältnis von Sorgearbeit und Erwerbsarbeit ist ein Problem, weil beide Arten von Arbeit in unserer Gesellschaft unterschiedlich bewertet werden und zwischen den Geschlechtern und sozialen Schichten ungleich verteilt sind.
1. Sorge ist gesellschaftlich notwendige, aber wenig anerkannte Arbeit
Sorgeaufgaben – Kinderpflege und -erziehung, Altenbetreuung und -pflege, Gesundheitspflege etc., Haushaltstätigkeiten – gehören in allen Gesellschaften der Welt fundamental zum menschlichen (Zusammen-)Leben. Sorgetätigkeit umfasst alles, was Menschen für sich und für Andere zum Erhalt, zur Pflege und zur Regeneration der Lebenskräfte tun, ob unentgeltlich im familialen Bereich oder erwerbsförmig in erzieherischen, sozialarbeiterischen, pflegenden Berufen bzw. im gesamten Sektor personennaher Dienstleistungen. Sorgearbeit ist gesellschaftlich notwendige Arbeit; ihre enorme ökonomische und kulturelle Bedeutung wird aber nicht angemessen wertgeschätzt. Das zeigt sich in der Vergütung und in den Arbeitsbedingungen erwerbsmäßiger Sorgearbeit ebenso wie in der Selbstverständlichkeit, mit der Gesellschaft und Politik auf die Sorgebereitschaft von Frauen setzen, ohne die Kosten – den Verlust von Einkommen, sozialen Sicherungsansprüchen und Lebensqualität – auch nur annähernd zu kompensieren und eine ausreichende, flächendeckend erreichbare unterstützende Infrastruktur bereitzustellen. Die Sorgepolitik in Deutschland ist weit davon entfernt, dem Anspruch der Nachhaltigkeit gerecht zu werden.
2. Sorgearbeit – zu Lasten der Erwerbsbeteiligung und sozialen Sicherheit
Sorge-Aufgaben und die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen sie wahrgenommen werden (müssen), verändern sich mit dem Gesellschaftswandel. Wichtige Einflussfaktoren sind die veränderten Generationen- und Geschlechterverhältnisse (eine geringere Geburtenrate, die höhere Lebenserwartung und der gestiegene Anteil älterer und sehr alter Menschen mit intensivem Unterstützungs- und Pflegebedarf v.a. in den letzten Lebensjahren) sowie die in den letzten Jahrzehnten leitende politische Erwartung, dass jede erwachsene erwerbsfähige Person ihren Lebensunterhalt selbst erwirtschaftet. Die biografische Verdichtung der Anforderungen, Sorgeaufgaben und Erwerbsarbeit miteinander zu vereinbaren, trifft die Geschlechter sehr ungleich: Frauen nehmen immer noch einen Großteil der unentgeltlichen familiären Sorgearbeit wahr; oft tragen sie gleichzeitig zum Familieneinkommen bei bzw. erwirtschaften ihren Lebensunterhalt selbst. Damit sind sie von dem Vereinbarkeitsproblem weitaus stärker betroffen als Männer.
Der zweite Gleichstellungsbericht der Bundesregierung weist einen erheblichen Gender-Care-Gap aus:
„Frauen verwenden durchschnittlich täglich 52,4 Prozent mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit als Männer. Umgerechnet sind das 87 Minuten Unterschied. So leisten Männer pro Tag im Schnitt zwei Stunden und 46 Minuten unbezahlte Sorgearbeit, bei Frauen sind es vier Stunden und 13 Minuten. […] Die größten Unterschiede zeigen sich bei 34-Jährigen: In dieser Altersgruppe beträgt der sog. Gender Care Gap 110,6 Prozent. Die Frauen verbringen täglich durchschnittlich fünf Stunden und 18 Minuten mit Care-Arbeit, die Männer dagegen nur zwei Stunden und 31 Minuten. In dieser Phase bündeln sich zentrale Lebensereignisse und -entscheidungen im Beruf sowie oft auch die Verantwortlichkeit für Kinder und Eltern. Mit zunehmendem Alter wenden Männer mehr Zeit für Care-Arbeit auf, Frauen dagegen etwas weniger.“
(BMFSFJ 2019)
Die geschlechterasymmetrische Verteilung der Sorge-Arbeit wirkt sich nicht nur in der Phase der konkreten Beanspruchung, sondern auch langfristig in erheblichem Maße auf Biografie und Lebensbedingungen der Sorgenden aus. Sie führt auch langfristig zur Schlechterstellung von Frauen (viel seltener Männer), die Sorge-Arbeit leisten, im Hinblick auf Einkommen, soziale Sicherheit und Gesundheit: Je aufwändiger und länger andauernd die Sorgeaufgaben sind, desto weniger können die Sorgenden einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Lücken in der Erwerbsbiografie mindern die sozialen Sicherungsansprüche; besonders prekär ist das für die Alterssicherung: Längerfristig ausgeübte familiäre Sorgearbeit birgt ein hohes Risiko der Altersarmut. Intensive und über lange Zeit wahrgenommene Sorgeaufgaben wirken sich häufig auch auf die körperliche und die psychische Gesundheit der Betroffenen aus, v.a. wenn und weil es an staatlichen Unterstützungsangeboten fehlt oder diese nicht zugänglich sind. Unter solchen Bedingungen geht die Sorgearbeit auf Kosten von Freizeit, Ausgleichs- und Regenerationsmöglichkeiten der Sorgenden.
3. Sorge-Verantwortung fair ermöglichen – Arbeit anders verteilen
Mit den tiefgreifenden Veränderungen von Geschlechterleitbildern und Generationenverhältnissen in der modernen Arbeitsgesellschaft sind die personellen Ressourcen für die Sorgearbeit, die traditionell primär den Frauen und der Familie zugeschrieben wurden, prekär geworden. Die Suche nach geschlechter- und generationengerechten Lösungen, die dem Anspruch guter Arbeit (in der Fachsprache auch decent work genannt) entsprechen, muss auf eine paradoxe Situation reagieren. Einerseits sind traditionelle Leitbilder nicht mehr zeitgemäß – die Vielfalt der modernen Lebenswirklichkeiten ist über sie hinweggegangen. Weder die traditionelle sog. Normalbiographie des erwachsenen (männlichen) Vollzeiterwerbstätigen noch das Modell der Familie mit traditioneller geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung (männlicher Alleinverdiener; Hausfrauenehe) taugen als normierende Leitbilder für eine Gesellschaftspolitik, die Frauen und Männer in der Verantwortung für sich selbst und für die ihnen Anvertrauten stärken und aktiv unterstützen will. Andererseits zeigen im gesellschaftlichen Bewusstsein und auch in Teilen der Politik die traditionellen Geschlechterrollen und die Muster der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung ein hohes Beharrungsvermögen. Solange etwa die Ausrichtung der Pflegepolitik in Deutschland vor allem auf die familiäre Pflege durch Angehörige setzt, ohne dass deren Tätigkeit angemessen kompensiert und unterstützt wird, trägt sie dazu bei, dass familiäre Care-Aufgaben und die damit verbundenen Risiken immer noch weit überdurchschnittlich von Frauen getragen werden. Auch dass im beruflichen Care-Sektor nach wie vor überwiegend Frauen tätig sind, wird durch die Bedingungen dieses Sektors begünstigt.
Dem Gender-Care-Gap entspricht im Bereich der Erwerbsarbeit ein erheblicher Gender-Pay-Gap (Gärtner, Lange & Stahlmann 2020). Beides zusammen trägt zum Gender-Pension-Gap, der Asymmetrie in der sozialen Absicherung der Lebensphase „Alter“ zu Lasten der Frauen, bei. Vor allem Frauen mit schlechteren Bildungsvoraussetzungen und mit weniger gut bezahlten Jobs sind bereit, ihre Erwerbstätigkeit zugunsten unbezahlter Sorgetätigkeit zurückzufahren, und verschärfen damit – oft vermutlich unbewusst – das Risiko, im Alter arm zu sein (Knauthe & Deindl 2019). Die Option, sich von familiären Pflegeaufgaben durch (meist irreguläre) Beschäftigung weiblicher ausländischer Care-Arbeiter*innen im Privathaushalt zu entlasten, steht nur wirtschaftlich hinreichend gut ausgestatteten Haushalten zur Verfügung; zudem basiert diese Option unter den herrschenden Bedingungen in Deutschland auf rechtlich und ethisch hoch problematischen Voraussetzungen: Die völlig entgrenzten Arbeitsverhältnisse sind typischerweise irregulär und die ausländischen Care-Arbeiter*innen werden unter hochgradig prekären Bedingungen eingesetzt (Quaing, Heimbach-Steins & Hänselmann 2021).
4. Schlussfolgerungen für geschlechtergerechte Sorge- und Erwerbsarbeit
Die skizzierte Situation macht deutlich, wie dringend es ist, die Vereinbarkeit von Sorge- und Erwerbsarbeit strukturell – sozialpolitisch – zu verbessern. Mit drei Thesen soll dies konkretisiert werden.
(1) Sorgearbeit darf nicht arm machen und kein Armutsrisiko darstellen.
Ob Menschen Sorge- und Erwerbsarbeit miteinander vereinbaren können, ohne schwerwiegende Nachteile zu erleiden, hängt nicht zuletzt von der Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse ab. Nehmen wir das Beispiel der ambulanten Altenpflege: Pflegekräfte werden dringend gesucht, aber es gibt zu wenig Vollzeitstellen; viele Professionelle (v.a. in den östlichen Bundesländern) können nicht in dem gewünschten Umfang erwerbstätig sein, was u.a. mit Problemen der Arbeitsorganisation und mit Arbeitsschutzregeln zu tun hat. Eine bedarfsgerechte und den Erwerbstätigen gerecht werdende Arbeitszeitorganisation ist dringend notwendig, um den Missstand zu überwinden, dass anhaltende (vielfach ungewollte) Teilzeitbeschäftigung in einem mäßig vergüteten Beruf vielfach zu prekären Lebensverhältnissen und nahezu zwangsläufig zu einer mangelhaften Absicherung der Lebensrisiken im Alter führt.
Ungeachtet der Lohnsteigerungen in den letzten Jahren gibt es auf allen Qualifikationsstufen große Unterschiede bei der Vergütung zwischen den Berufsfeldern (Kranken-/Altenpflege), den Institutionentypen (stationär/ambulant) und den Regionen in Deutschland. Die nun endlich kommende Tarifbindung in den Pflegeberufen steuert der Tendenz entgegen, den Preisdruck am Pflegemarkt auf die Pflegekräfte abzuwälzen, die v. a. bei privatwirtschaftlich gewinnorientierten Dienstleistern zu beobachten ist.
Schließlich gilt es zu verhindern, dass pflegende Angehörige arm werden, weil sie pflegen. Es braucht eine faire Kompensation des Verlustes an Erwerbseinkommen, der bei langfristig übernommenen zeitaufwändigen Pflegeaufgaben eintritt. Dazu wird von verschiedenen Seiten die Einführung einer Art Transfereinkommen für Pflegende, wenn sie für die Pflege ihre Erwerbstätigkeit reduzieren oder aufgeben müssen, propagiert (sog. Pflegendengeld, vgl. hierzu: Emunds et al. 2022). Zum anderen müssen die familiären Pflegetätigkeiten endlich angemessen für den Erwerb von Alterssicherungsansprüchen berücksichtigt werden, ähnlich wie es inzwischen bei den Erziehungszeiten der Fall ist.
(2) Sorgearbeit darf nicht krank machen.
Wie sehr es von den Arbeitsbedingungen abhängt, ob Sorgearbeit gesundheitlich verträglich oder gesundheitsschädigend ist, lässt sich wiederum am Beispiel der Pflege hochaltriger Menschen nachvollziehen. Die Arbeit ist körperlich anstrengend und psychisch beanspruchend. Pflegekräfte und pflegende Angehörige klagen vielfach über Rückenprobleme, aber auch über Erschöpfung und Burnout. Um diesen Gefahren vorzubeugen, sind faire Arbeitszeitregelungen und die verlässliche Einhaltung von Freizeiten besonders wichtig; technische Hilfsmittel können u.a. dazu beitragen, dass rückenschonend gearbeitet werden kann. Angesichts der angespannten Personalsituation braucht es strukturelle Maßnahmen zur Kompensation von Personalengpässen (z.B. Personal-Pools). Pflegende Angehörige brauchen – überall in der Fläche – niederschwellig erreichbare Unterstützungs- und Entlastungsangebote, Beratung und Begleitung.
(3) Sorgearbeit ist Aufgabe der ganzen Gesellschaft.
Es genügt nicht, immer wieder zu beteuern, wie wichtig Sorgearbeit für die ganze Gesellschaft ist. Sie muss – ob im Rahmen familialer Solidarität oder erwerbsförmig erbracht – als gesellschaftliche Arbeit wahrgenommen und anerkannt werden. Angesichts der überproportionalen Beanspruchung weiblicher Arbeitskraft für Sorgeaufgaben gilt es dringend, Bedingungen zu schaffen, damit Sorge- und Erwerbsarbeit geschlechtergerecht geteilt und soziale Sicherheit für beide Geschlechter gesichert werden. Dazu wird es notwendig sein, die wöchentliche Erwerbsarbeitszeit gleichmäßiger zwischen den Geschlechtern zu verteilen und den Dynamiken im Lebenslauf – Bildungs-, Erziehungs-, Pflegezeiten – in den Erwerbsbiografien Raum zu geben. Es muss darum gehen, für alle Geschlechter Wahlfreiheit in Bezug auf die Wahrnehmung von Sorge- und Erwerbsarbeit (sowie lebensbegleitender Bildung) strukturell zu ermöglichen. Der Zweite Gleichstellungsbericht der Bundesregierung spricht in diesem Sinne von einem Erwerb- und Sorge-Modell der Arbeit. Das Arbeitszeitaufkommen muss für alle Geschlechter lebenslaufbezogen so flexibilisiert werden, dass Frauen und Männer zwischen Vollzeit- und Teilzeiterwerbstätigkeit leichter und ohne Verlust sozialer Sicherungsansprüche wechseln können. Dies umzusetzen, wäre ein großer Schritt zu einer geschlechtergerechten und nachhaltig tragfähigen Wahrnehmung von Sorge- und Erwerbstätigkeit.
Über die Autorin:
Prof. Dr. Marianne Heimbach-Steins ist Direktorin des Instituts für Christliche Sozialwissenschaften der Universität Münster. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören u.a. Genderfragen im Horizont christlicher Sozialethik sowie sozialethische Fragen im Horizont von Familien- und Sozialpolitik.
Quellen:
Die im Blogbeitrag vorgestellten Überlegungen basieren auf kooperativen sozialethischen Forschungen zur Pflegearbeit im Privathaushalt am Institut für Christliche Sozialwissenschaften der Universität Münster und am Oswald von Nell-Breuning-Institut für Wirtschafts- und Gesellschaftsethik der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt am Main. Vgl. dazu:
Emunds, B., Hagedorn, J., Hänselmann, E. & M. Heimbach-Steins (Hrsg.), unter Mitarbeit von Quaing, L. (2021): Pflegearbeit im Privathaushalt. Sozialethische Analysen (GER 18), Paderborn.
Emunds, B., Hagedorn, J., Heimbach-Steins, M. & L. Quaing (2022): Häusliche Pflegearbeit gerecht organisieren (Arbeitsgesellschaft im Wandel), Weinheim/Basel.
Weitere Quellen:
BMFSFJ (2019): Gender Care Gap – ein Indikator für die Gleichstellung. Online unter: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/gender-care-gap/indikator-fuer-die-gleichstellung/gender-care-gap-ein-indikator-fuer-die-gleichstellung-137294 (abgerufen: 29.05.2022).
Emunds, B. & M. Heimbach-Steins (2021): Pflegepolitische Reformbedarfe, in: Emunds et al. (Hrsg.), S. 242-258, hier: S. 251-253.
Gärtner, D., Lange, K. & A. Stahlmann (2020): Was der Gender Care Gap über Geld, Gerechtigkeit und die Gesellschaft aussagt. Einflussfaktoren auf den Gender Care Gap und Instrumente für seine Reduzierung. Bericht im Auftrag des BMFSFJ. Berlin. Online unter: https://www.bmfsfj.de/resource/blob/154696/bb7b75a0b9090bb4d194c 2faf63eb6aa/gender-care-gap-forschungsbericht-data.pdf.
Knauthe, K. & C. Deindl (2019): Altersarmut von Frauen durch häusliche Pflege. Gutachten im Auftrag des Sozialverband Deutschland e. V.. Online unter: https://www.sovd.de/fileadmin/bundesverband/pdf/broschueren/pflege/SoVD_Gutachten_Altersarmut_Frauen2019.pdf.
Quaing, L., Heimbach-Steins, M. & E. Hänselmann (2021): Anerkennungsdefizite bei Live-Ins. In: Emunds et al. (Hrsg.), S. 121-241, hier: S. 162-196.
Beitragsbild:
Canva.com