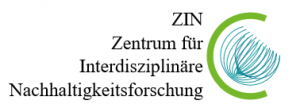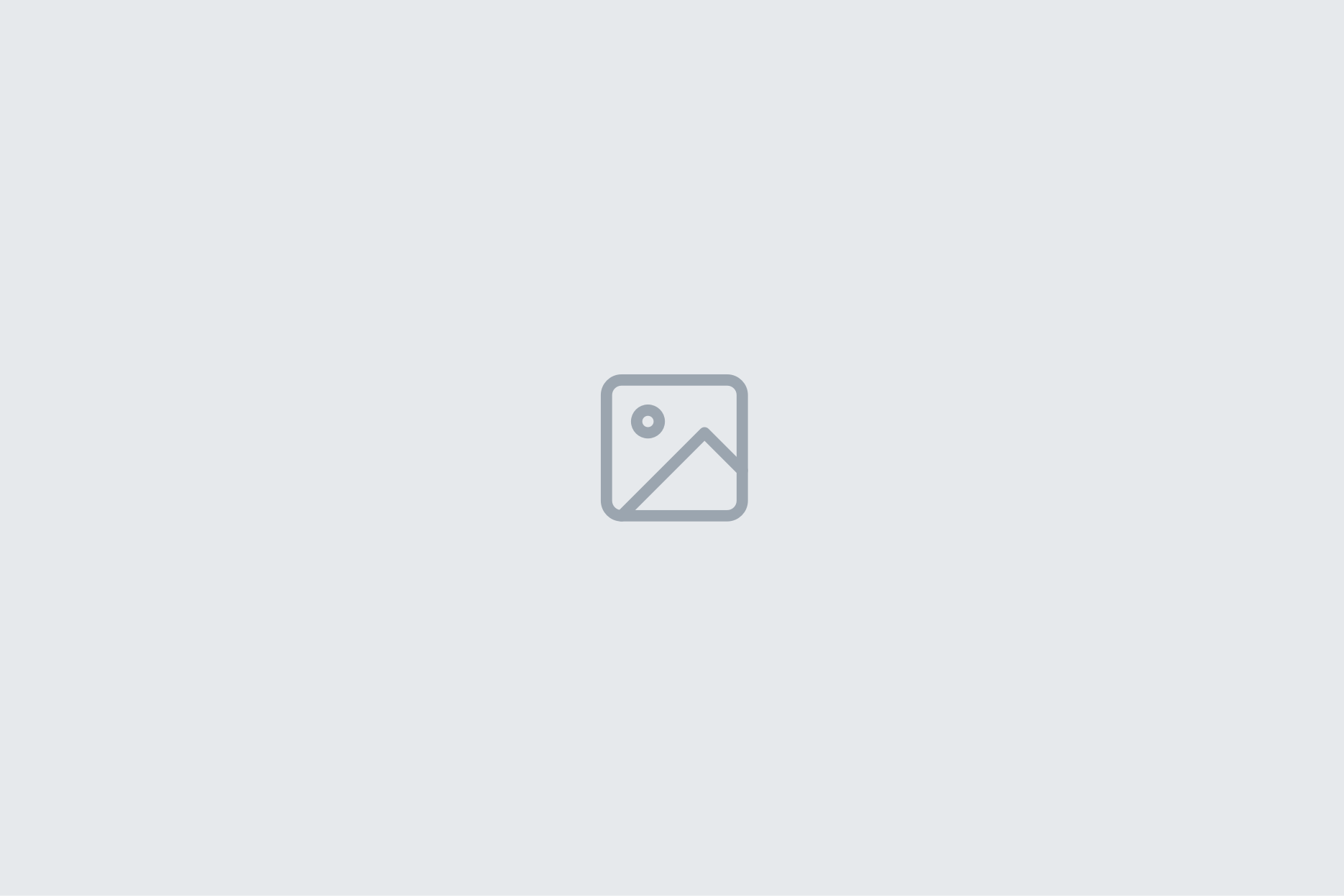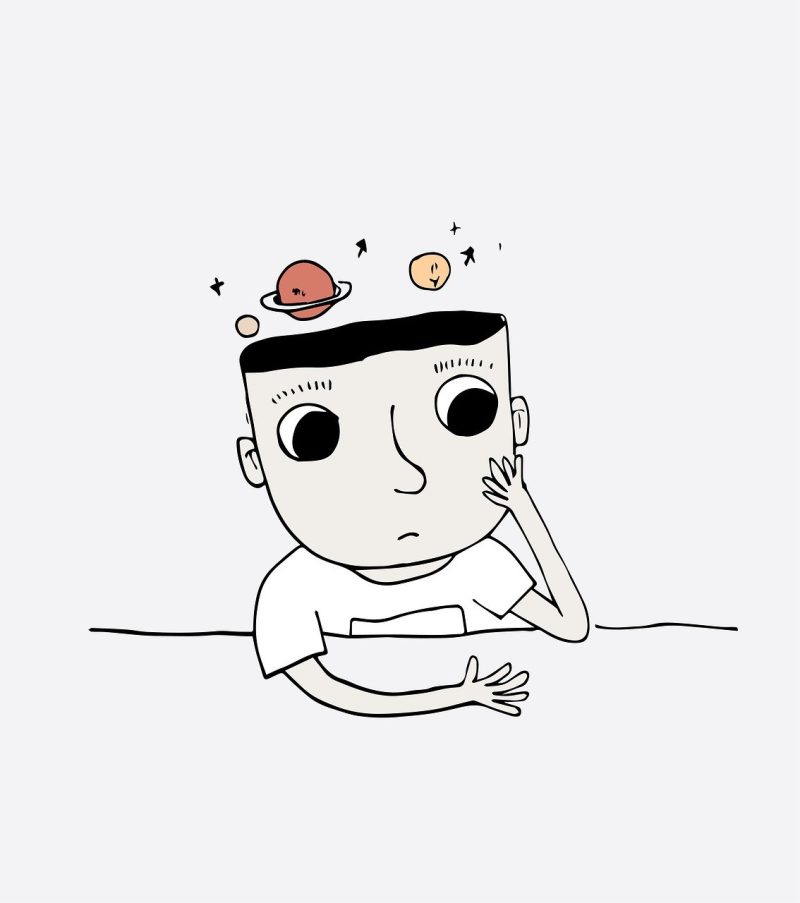David Rott
Die Schule steckt in der Krise – eigentlich schon so lange, wie es die Schule gibt. Da muss ich gar nicht die Corona-Pandemie bemühen oder die Ergebnisse der IGLU Studie, die zeigt, dass ein Viertel der Schüler*innen am Ende der Grundschule nicht richtig lesen kann. Ich könnte mir auch den Mangel an qualifizierten Lehrpersonen vornehmen. Oder wie wäre es mit der Frage, warum immer noch so viele Schüler*innen an Förderschulen separiert beschult werden, obwohl in Deutschland seit 2009 ein inklusives Bildungssystem errichtet werden soll?
Kinderrechte
Wenn wir versuchen, Schule anders zu denken, dann stellt sich die Frage, was wir zum Ausgangspunkt machen wollen. Mein Vorschlag: die Kinderrechte. Die Kinderrechte sind eine Ausdifferenzierung der Erklärung der Allgemeinen Menschenrechte von 1948. Die UN-Kinderrechtskonvention wurde 1989 verabschiedet und auch von Deutschland als Vertragsstaat unterzeichnet. Vollumfänglich ratifizierte Deutschland die Kinderrechtskonvention erst 2010. Seitdem gilt sie in Deutschland für alle Kinder, etwa auch für solche, die als Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind.
Die Kinderrechtskonvention soll helfen, Kinder als Gruppe stärker zu beachten, da sie von Diskriminierung und Marginalisierung bedroht sind. Als Kinder werden dabei alle Menschen im Alter zwischen 0 und 18 Jahren verstanden.
Die Kinderrechte umfassen 54 Artikel, die für einen Überblick zusammengefasst werden können. Es gibt:
- die Schutzrechte, da Kinder als Gruppe identifiziert werden, die oftmals körperliche und seelische Gewalt, Misshandlung oder Missbrauch erfahren
- die Förderrechte, die darauf abzielen, dass auch Kinder eine bestmögliche Gesundheitsversorgung, Bildung, soziale Sicherheit und gute Lebensbedingungen erhalten
- die Beteiligungsrechte, die einen freien Zugang zu Informationen und Medien sowie das Recht auf freie Meinungsäußerung festschreiben.
Als verbindendes Element gibt es das Primat des Kindeswohls, im englischen Original: Best Interest of the Child. Dieses muss beachtet werden, wenn Entscheidungen getroffen werden, die auch Kinder betreffen. Nimmt man diese Idee ernst, dann müssen wir uns Schule und Unterricht anders vorstellen.
Schutzrechte
Schüler*innen müssen auch in der Schule vor Gewalt geschützt werden, die sowohl von den Erwachsenen als auch von den Schüler*innen selbst ausgehen kann. Annedore Prengel und andere Kolleg*innen haben in ihren Untersuchungen, der INTAKT-Studie, etwa gezeigt, dass ein Viertel aller Interaktionen zwischen Lehrpersonen und Schüler*innen verletzend oder stark verletzend sind.
Wenn wir an unsere eigenen Schulerfahrungen zurückdenken, dann fallen uns solche Verletzungen sicher ein. In meiner Grundschulzeit hat etwa unser Schulleiter meinen Sitznachbarn mit seinem Schlüsselbund beworfen, weil wir gequatscht haben – und ihn getroffen. Mein Erdkundelehrer an der weiterführenden Schule hat mich vorgeführt, weil ich meine Hausaufgaben nicht hatte. Ein Lehrer auf der Oberstufen-Studienfahrt hat sich rassistisch über zwei Mitschüler geäußert und wurde dabei von der anderen Lehrperson auch noch gedeckt. Solche oder ähnliche Erfahrungen haben wahrscheinlich viele gemacht, die durch die Schule gegangen sind.
Auch das Verhalten von Schüler*innen kann stark problematisch sein, wie mit den Begriffen Mobbing und Bullying deutlich gemacht werden kann. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Kinder vielfältigen Gewalterfahrungen an der Schule ausgesetzt sind. Für Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben das etwa Anne Hartmann und Kolleg*innen herausstellen können.
Auch hier können wir in den dunklen Ecken des Nähkästchens stöbern. Ein Junge in meiner Klasse wurde in der Mittelstufe immer ins Fußballtor gestellt und die guten Fußballer hatten nichts anderes als Ziel, als ihm mit voller Wucht die Brille von der Nase zu schießen. Der Sportlehrerin war es egal und so ging das so lange, bis dieses Spiel den Reiz verlor. In der Grundschule durfte ein Mädchen oft nicht mitspielen und blieb auf dem Schulhof alleine stehen, weil die Bandenchefin sie nicht mochte. Der Grund: Ihre Klamotten waren aus der Zeit gefallen. Dass das daran lag, dass die Eltern nur sehr wenig Geld hatten und ihrer Tochter nichts anderes kaufen konnten, habe ich erst sehr viel später verstanden.
Nehmen wir die Kinderrechte ernst, dann muss es darum gehen, solche negativen Erfahrungen zu vermeiden. Oder, noch besser: Wie bekommen es Lehrpersonen und Schüler*innen hin, dass die Schule ein Ort ist, an der sich alle sicher fühlen können? Es geht also darum zu schauen, was gute Erfahrungen schafft, an denen die Schüler*innen und die Lehrpersonen gleichermaßen wachsen können. Anhand der Förderrechte und später der Beteiligungsrechte lassen sich Ideen entwickeln, wie dies in der Schule funktionieren kann.
Förderrechte
Kinder haben ein Recht darauf, in ihrer Entwicklung unterstützt zu werden. Es geht dabei etwa um Fragen der Ernährung und der Bewegung. In den Schulfächern können die Schüler*innen lernen, was gute Ernährung ist. Und im Drumherum können den Schüler*innen Angebote gemacht werden, sich gesund zu ernähren – in der Mensa oder auch im Klassenzimmer, etwa durch das Bereitstellen von Obst und Gemüse. Dies ist auch durch gezielte staatliche Förderung möglich, wie es das Programm Schulobst in NRW zeigt. Damit kann die Schule einen Rahmen schaffen, der allen Schüler*innen den Zugang zu gesundem Essen ermöglicht. Die Abhängigkeit vom Geldbeutel der Eltern wird zumindest in Teilen gesenkt.
Bei der Bewegung ist es das Gleiche: Im Sportunterricht gibt es den Auftrag, Erziehung mit und zum Sport zu gewährleisten. Und auch hier gibt es das Drumherum, etwa in der Ganztagsbetreuung. Schulen können sich bewusst öffnen und Bewegungsangebote schaffen, etwa durch das Einbinden lokaler Sportvereine. Dabei kann es um Leistung gehen, aber vor allem auch darum, Spaß an der Bewegung zu vermitteln.
Die Frage nach Bildung, die die meisten wahrscheinlich als die Hauptaufgabe der Schule verstehen, ist bei diesen Beispielen dabei erst zum Teil mit aufgenommen. Eine Schule, die sich an den Kinderrechten orientiert, ermöglicht eine personenorientierte Förderung, unabhängig davon, woher die Schüler*innen kommen, wie die Eltern heißen oder welchen Beruf die Eltern ausüben.
Hier stoßen wir auf Vorbehalte: Wie soll das alles gehen? Wer soll das finanzieren? Wo sollen die Personen herkommen, die das ausgestalten? Das sind wichtige und zentrale Fragen und es wäre mehr als naiv, würde ich sie hier ausklammern.
Ich versuche, diese Fragen auch aus der Sicht der Kinderrechte zu beantworten. Das Kindeswohl ist ein entscheidendes Orientierungsmerkmal. Aber wer entscheidet eigentlich, was zum Wohle der Kinder ist? Die Eltern? Die Lehrpersonen? Konsequenterweise müsste es heißen: die Kinder, gemeinsam mit den Erwachsenen, die für sie Verantwortung tragen. In einem Gastbeitrag in der Wochenzeitung DIE ZEIT verweisen Klaus Hurrelmann und Ullrich Bauer darauf, dass Eltern und Lehrpersonen gleichermaßen für die Erziehung der Kinder verantwortlich sind und sich kooperativ an den Interessen der Kinder zu orientieren haben.
Die Kinder, und das ist das Argument, das sich aus den Kinderrechten ergibt, sind stärker in Entscheidungen mit einzubinden.Bezüglich der Bildung müsste das auch heißen, dass Schüler*innen mitentscheiden können, was sie lernen, wie sie lernen, womit sie lernen, mit wem sie lernen, wann sie lernen und wie sie hierzu Rückmeldungen erhalten. Orientierungspunkt könnte dabei das zweigestufte Curriculum sein, das Annedore Prengel beschreibt. Hierbei gibt es das Kerncurriculum, das von Erwachsenen vorgegeben und verantwortet wird und Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben oder Rechnen umfasst, und Freiräume, die die Schüler*innen mit Projekten und eigenen Ideen ausfüllen können. Leitlinien im Sinne der Inklusion sind nicht Minimalstandards, sondern Stufen, die je nach Voraussetzungen von den Schüler*innen erreicht werden können. Fächer stehen dabei in Teilen zumindest zur Diskussion, eine einseitige Orientierung an Kompetenzen greift aber auch zu kurz.
Dies spricht – und das ist ein Rückgriff auf die Frage nach den Ressourcen – für eine Öffnung der Schule. Es muss darum gehen, dass Eltern, Expert*innen aus unterschiedlichen Bereichen, Trainer*innen, Sozialarbeiter*innen und andere Professionelle mit in den Schulen eingebunden werden. Lehrpersonen sind und bleiben Expert*innen für das Lernen und für ihre Fächer. Aber die Lehrpersonen können auch Welten öffnen, wenn sie die Möglichkeit dazu bekommen.
Beteiligungsrechte
Damit komme ich zum letzten Bereich, den Beteiligungsrechten. Einige Elemente sind in den Schulen schon fest verankert, etwa das Amt der Klassensprecher*innen. Zudem gibt es Formate wie den Klassenrat, in dem Schüler*innen ihre Anliegen zum Klassen- und Schulleben thematisieren können. Doch wie lässt sich Beteiligung weiter verfestigen?
Im Rückgriff auf das Kritische Denken haben mein Kollege Marcus Kohnen und ich an anderer Stelle deutlich gemacht, dass es darum gehen muss, in der Schule alle Schüler*innen anzusprechen und einzubinden. Im Sinne einer inklusiven Ausrichtung des Bildungssystems muss es darum gehen, allen Schüler*innen, egal woher sie kommen, welche Sprache sie sprechen oder welche kognitiven Voraussetzungen sie mitbringen, das Treffen von Entscheidungen zu ermöglichen. Sie müssen in der Schule in die Lage versetzt werden, sich Informationen zu verschaffen, müssen diese bewerten können und auf dieser Grundlage Entscheidungen für das eigene Handeln treffen können. Dies scheint ein entscheidender Faktor dafür zu sein, Kinder an gesellschaftlichen und politischen Entscheidungen zu beteiligen.
Für die Schule heißt das, und hier knüpfe ich wieder an meine vorausgehenden Überlegungen an, dass sie auch an der Ausrichtung des Unterrichts beteiligt werden müssen. Im Unterricht muss es Raum geben für ihre Fragen und Probleme, für ihre Anliegen und Projekte. Mit den Ideen der Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) und den UN-Nachhaltigkeitszielen sind dabei grundlegende Konzepte erstellt worden, die bereits Perspektiven für eine solche Gestaltungsmacht auf Seiten der Schüler*innen eingeschrieben haben.
Hierfür, und das sollte klar sein, benötigen die Schüler*innen Basiskompetenzen. Sie müssen Lesen, Schreiben und Rechnen können. Aber, und das sind Beobachtungen aus eigenen Projekten im schulischen Kontext, diese Kompetenzen erwerben die Schüler*innen vor allem dann, wenn sie sie sinnvoll in Zusammenhängen lernen können. Wer Informationen braucht, der muss Lesen oder Zuhören können. Wer die eigenen Gedanken ordnen will, ist oftmals auf das Schreiben zurückgeworfen. Und die Schüler*innen erkennen genau dies sehr schnell und fordern für sich selbst ein, ihre Kompetenzen in diesen Bereichen zu erweitern, um ihren Fragen und Interessen weiter nachgehen zu können.
Die Lehrpersonen werden dabei nicht zu teilnahmslosen Statist*innen. Sie verfügen oftmals über deutlich mehr Fachwissen und können vor allem helfen, die Lernprozesse der Schüler*innen zu strukturieren und zu begleiten. Sie können die richtigen Fragen stellen, ohne immer die Antwort geben zu müssen.
Dies wären Strategien, die helfen können, mehr Mitbestimmung in die Schule zu holen. Dabei sind es demokratische Prozesse, die eingeübt werden können, aber eben auch Meinungsbildungsprozesse, die stark an den Unterricht angebunden sind. Wichtig ist dabei, dass die Fragen, Anliegen und Probleme der Schüler*innen ernstgenommen werden und dass sie auch relevante Entscheidungen mit beeinflussen können. Damit geht es nicht um ein simples ‚Kinder an die Macht‘, wie Herbert Grönemeyer es beschworen hat, sondern darum, Kinder als echte Partner*innen in Entscheidungsprozessen anzunehmen, Verantwortung zu teilen und Beteiligung auch einzufordern. Dies sind Dinge, die auch ohne den Einsatz zusätzlicher Ressourcen in der Schule möglich sind, sondern vor allem im Sinne der Öffnung von Schule verstärkt Flexibilität einfordern.
Die Kinderrechte als den Ausgangspunkt zur Gestaltung von Schule und Unterricht zu setzen, eröffnet vielfältige Perspektiven, die oftmals im Kleinen anfangen. Viele Schritte in diese Richtung sind in der Schule bereits möglich und werden öffentlich gefördert. Geschaffen werden können hiermit positive Erfahrungen seitens der Schüler*innen, die sich sicher fühlen, die sich entwickeln können und die in Entscheidungen als echte Partner*innen wahrgenommen werden.
Aber auch seitens der Lehrpersonen, die im System so stark gefordert sind, ergeben sich diese Möglichkeiten. Auch für sie ist Schule ein Raum, der Sicherheit geben sollte, in denen sie sich selbst weiterentwickeln können, indem sie mit jungen Menschen zusammenarbeiten, von ihnen lernen, aber auch ihr eigenes Wissen weitergeben. Und die Frage der Entscheidungen ist auch für sie zentral: Wenn Entscheidungen gemeinsam getroffen werden, dann ziehen alle Beteiligten an einem Strang, es gibt eine größere Zufriedenheit in der Schule und auch eine stärkere Wertschätzung für die pädagogische Arbeit, die geleistet wird.
Getan werden muss und kann hier noch einiges. Und das hat natürlich auch mit Ressourcen zu tun: Dabei geht es aber nicht nur um Geld, sondern auch um die Frage, wie Zeit in der Schule genutzt werden soll oder kann. Die Kinderrechte können hier für Lehrpersonen, die Schulen, aber auch für die Verantwortlichen im Bildungssystem eine spannende Perspektive für die Ausrichtung schulischer Bildung werden.
Über den Autor:
David Rott ist Studienrat im Hochschuldienst an der Universität Münster. Er arbeitet im Institut für Erziehungswissenschaft in der Arbeitseinheit Begabungsforschung und Individuelle Förderung in der Lehrer*innenbildung und der Schüler*innenförderung. Seine Themenschwerpunkte sind Forschendes Lernen, Begabungsförderung, Kritisches Denken und Kinderrechtebildung.