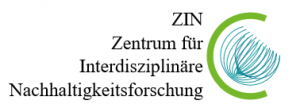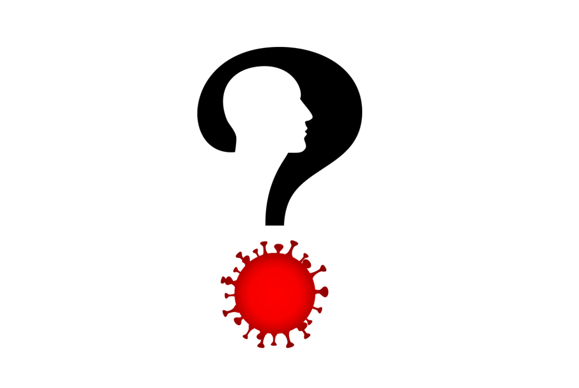Wir haben einen neuen Gegner. Er ist winzig, aber er hat das Potential, unsere Gesellschaft wie wir sie kennen aus den Angeln zu heben. Der Coronavirus als Hebel in eine neue Zukunft? Die möglichen Veränderungen hin zu einer „neuen Normalität“ werden gefürchtet oder als Gelegenheit zum Lernen und Weiterentwickeln begrüßt. Dies bringt einerseits die Frage mit sich, ob und inwieweit ein Lernen aus dieser kollektiven Erfahrung möglich ist. Risikobewusstsein ist hier der Schlüsselbegriff und die Forschung hat hierzu das Paradox beizutragen, dass Erfahrung alleine zumindest nicht ausreichend ist, um auf die nächste Katastrophe vorbereitet zu sein. Dies gilt vermutlich umso mehr, da im Moment die persönliche Betroffenheit von den politischen Eindämmungsmaßnahmen hoch ist. Die persönliche Betroffenheit durch den Virus im Sinne von eigener Erkrankung oder gar dem Tod nahestehender Menschen, ist jedoch nicht im gleichen Maße verbreitet. Ob wir als Gesellschaft nach dieser kollektiven Erfahrung auf die nächste Pandemie also besser vorbereitet sein oder gar als Vorsorge unser Verhalten verändern werden, darf erst einmal bezweifelt werden.
Aus der aktuellen Krise für die Gefahren der Zukunft lernen
Andererseits ist es nun – mitten in der Krise, die jedoch durch die politischen Maßnahme bisher zu keiner medizinischen Katastrophe geworden ist – der richtige Moment, um generell darüber zu reden, wie wir uns als Gesellschaft auf das Unbekannte, möglicherweise Katastrophische vorbereiten möchten: „Corona“ ist noch ein totales, die mediale Öffentlichkeit dominierendes Thema und die Perspektive, dass uns eine andere Gefahr in der Zukunft ebenso tiefgreifend treffen könnte, ist hier anschlussfähig. Der gesellschaftliche Diskurs um die politische Bearbeitung der Krise ist in vollem Gange und schließt immer mehr wissenschaftliche Disziplinen und gesellschaftliche Perspektiven ein. Das am Anfang der Krise vielleicht durchaus nötige Konzentrieren auf epidemiologische Fakten ist dem politischen Konflikt darum gewichen, welche Eingriffe in die Grundrechte nötig sind (und: wie lange, wie tiefgreifend, wie einheitlich im ganzen Bundesgebiet) und wie diese legitimiert sein müssen.
Doch der Diskurs darf nicht enden, wenn hier (hoffentlich) ein Kompromiss gefunden ist. Die Reflexion und das Lernen aus dieser Krise ist für die Zukunft der nächste logische Schritt. Doch wer sagt uns, dass die nächste große Gefahr eine ist, mit der wir als Gesellschaft uns bereits auseinandergesetzt haben? Donald Rumsfeld hat in einer berühmt gewordenen Unterscheidung known knowns, known unknowns und unknown unknowns (d.h. Wissen, Nicht-Wissen, das uns als solches bekannt ist und Nicht-Wissen, das uns zumindest bisher nicht bekannt ist, also Ungewissheit) voneinander abgegrenzt. Diese Unterscheidung kann uns vor allem daran erinnern, dass uns so manches Nicht-Wissen gar nicht bewusst ist und wir uns im Kern die Frage stellen müssen, wie wir mit Ungewissheit und Nicht-Wissen umgehen möchten. In der Konsequenz ist es also höchste Zeit, auch darüber zu reden, wie wir damit umgehen wollen, dass wir die Gefahren, die uns in der Zukunft bedrohen, nicht kennen und zum Teil auch gar nicht kennen können. Es gibt durchaus auch in Deutschland politische Initiativen, die sich mit möglichen zukünftigen Gefahren und ihren Konsequenzen beschäftigen. Es gab beispielsweise bereits 2012 eine Risikoanalyse des BBK (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) zu Pandemien. Unser aktuelles Risikobewusstsein und unsere Erfahrungen aus der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, wie mit dem Risiko durch den Coronavirus umzugehen ist, sind sehr wertvoll für die Diskussion über die Gefahren der Zukunft und wie riskant wir als Gesellschaft diese bewerten. Wir können aus diesen Erfahrungen lernen, dass es viele Perspektiven und Bewertungen gibt, die valide sind und in der politischen Entscheidungsfindung berücksichtigt werden müssen.
Doch selbst wenn wir uns als Gesellschaft mit zukünftigen Gefahren auseinandergesetzt haben, muss diese Auseinandersetzung noch Eingang in den politischen Raum finden und dort bearbeitet werden. Dort, in den politischen Institutionen und Behörden, ist vor allem ein Abgleich zu den Bewältigungskapazitäten jeglicher Art (organisatorisch, materiell, aber auch politisch) nötig, um Lücken oder Bedarfe zu erkennen. Weiterhin ist dort die Steuerung oder Förderung von präventivem oder ein Risiko minderndem Handeln möglich. Doch die Bearbeitung im politischen Raum schafft weitere Schwierigkeiten: öffentliche Mittel, das heißt die Haushalte der Bundes- und Landesregierungen und der Kommunen sind notwendigerweise begrenzt und neben der Beschäftigung mit zukünftigen Gefahren müssen viele andere Aufgaben erfüllt werden. Wie sollten sie also investiert werden? Im Hinblick auf spezifische Gefahren wie eine zukünftige Pandemie oder ein zukünftiges Hochwasser? Oder in der Auseinandersetzung mit Konsequenzen, die von unterschiedlichen Ereignissen ausgelöst werden könnten, wie zum Beispiel einem Ausfall der Stromversorgung? Sollten sie investiert werden für die Vorbereitung darauf, dass die Gefahr eintritt? Oder lieber in Vorsorge, also um sie vielleicht präventiv gar nicht erst eintreten zu lassen bzw. um die Risiken zu reduzieren?
Risiken bewerten: ein gesellschaftlicher Prozess, der vor der Krise stattfinden muss
Die Vorteile, sich nicht erst wenn die Gefahr eintritt und zur Katastrophe zu werden droht mit ihr zu beschäftigen, und dass trotz Unsicherheit und Nicht-Wissen, sind vielfältig. Dies ermöglicht, einen gesellschaftlichen Diskurs zu führen und bewusst zu entscheiden: Welche Gefahren sind wichtiger als andere, also diejenigen, auf die wir uns auf jeden Fall vorbereiten oder gegen die wir vorsorgen wollen? Wie priorisieren wir Schutzgüter und wo setzen wir Grenzen? Dies ist eine Debatte, die wir in der Corona-Krise nun erst in der schwierigen, emotional aufgeladenen Situation führen, wenn der Schutz vieler individuellen Leben gegen die Auswirkungen einer schweren, globalen Wirtschaftskrise, individuelle Freiheitsrechte und weitere Werte abgewogen werden muss. Wer ist in welchem Maße in der Pflicht, der Staat und/oder der/die Einzelne? Gerade das Spannungsfeld von Schutzerwartung an den Staat und Eigenverantwortung sollte Teil der gesellschaftlichen Debatte sein.
Auch ohne akute Krise ist dies ein komplexer und herausfordernder Prozess. Es gibt jedoch Verfahren wie beispielsweise die Risikogovernance, mit denen gesellschaftliche Abwägungen organisiert und strukturiert werden können. Transparenz und Kommunikation sind dabei zentral. Alle betroffenen AkteurInnen und auch die Bevölkerung müssen eingebunden werden. Der Fokus auf eine spezifische Katastrophe würde damit ersetzt durch einen Prozess, in dem alle Beteiligten alle möglichen Gefahren benennen könnten, die sie sehen. (Dies dient dazu, den Raum des Nicht-Wissens größer und des Ungewissen kleiner zu machen, da jede/r potentiell andere Gefahren wahrnimmt oder kennt.) Alle würden sodann ihre Bewertung einbringen, welche Gefahren sie für besonders relevant halten, sodass sie auf jeden Fall bearbeitet werden sollten. Dies würde automatisch eine Diskussion mit sich bringen, wo Synergien in der Bearbeitung von Risiken möglich sind und welche Konflikte zwischen Schutzgütern zu erwarten wären. Am Ende könnte eine Entscheidung darüber getroffen werden, welche Risiken auf welche Weise bereits jetzt minimiert werden sollten und auf den Eintritt welcher Gefahren man sich mit Bewältigungskapazitäten vorbereiten sollte. Im Idealfall hätte man Leitlinien, wie mit Zielkonflikten umgegangen werden sollte. Doch einmal ist nicht genug: Dieser Prozess müsste immer wieder durchgeführt werden, um zu überprüfen, ob die getroffenen Maßnahmen erfolgreich waren, ob vielleicht neue Gefahren erkannt wurden und ob die gefundenen Kompromisse noch von allen Seiten mitgetragen werden können. Doch auch andere politische Strategien als Risikogovernance sind möglich. Die bereits angesprochene Förderung der Resilienz würde beispielsweise die Eigenverantwortung aller AkteurInnen und auch jedes/r Einzelnen stärker in den Fokus rücken und den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern, in der Annahme, dass gesellschaftliche Resilienz uns hilft, egal welche Gefahr droht.
Die Lehre aus der Krise: Jetzt kommt die Zeit, um über zukünftige Gefahren nachzudenken
Welche Gefahr uns nach Corona erwartet? Diese Ungewissheit kann uns niemand nehmen. Wir müssen mit ihr leben und sollten möglichst produktiv mit ihr umgehen. Sie zu thematisieren, indem wir uns mit möglichen zukünftigen Gefahren auseinandersetzen, sie für uns als Gesellschaft bewerten und daraufhin eine politische Strategie wählen, wie wir mit ihnen umgehen, ist ein sinnvoller Weg. Damit können wir zumindest einen Teil der Ungewissheit in Nicht-Wissen konvertieren, dessen wir uns bewusst sind und uns known unknowns erschaffen. Gewiss: Ein solcher Prozess würde uns mit vielen schwierigen Fragen konfrontieren, die sich in der Folge ergeben. Doch auf dieser Basis können wir uns dafür entscheiden, (präventiv, Risiken minimierend, vorbereitend oder vielleicht auch gar nicht) zu handeln, statt im Ungewissen auf die nächste Katastrophe zu warten.
Zu der Autorin: Christine Prokopf war Doktorandin am Lehrstuhl für Internationale Beziehungen und Nachhaltige Entwicklung am Institut für Politikwissenschaft der WWU Münster. Ihre Dissertation mit dem Titel „Handeln vor der Katastrophe als politische Herausforderung: Mehr Vorsorge durch die Governance von Risiken“ ist kürzlich bei Nomos erschienen.
Nachweis Titelbild: https://pixabay.com/ (jedoch eigenbearbeitete Version)