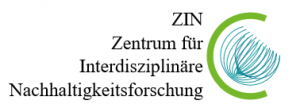Martin Winter
Leistungsstark, schnell wiederaufladbar und kostengünstig muss sie sein. Gleichzeitig soll sie lange halten und sicher sein. Über viele Jahre hinweg haben diese Faktoren über das Für und Wider einer Batterie entschieden. Mittlerweile ist ein weiterer, entscheidender Parameter hinzugekommen: Batterien müssen nachhaltig sein. Doch was bedeutet Nachhaltigkeit in der Batterieforschung? Die Facetten sind vielseitig, denn Nachhaltigkeit muss über den gesamten Lebenszyklus der Batterie berücksichtigt werden: beginnend bei den Ausgangsmaterialien über die Herstellung bis hin zum Recycling – und das nicht nur mit Blick auf Umwelt- und Ressourcenschonung, sondern auch auf anderen Ebenen wie etwa aus moralischer und ethischer Perspektive.
Nachhaltige, sichere und hochperformante Energiespeicher sind zeitgleich Grundlage unseres Alltags wie auch Wegbereiter für die Zukunft: ob Smartphones und Laptops im Dauereinsatz, intelligente Gebäudetechnik, der Ausbau erneuerbarer Energien, vernetzte Ladesäulen für Elektroautos oder die Diskussion um Flugtaxis. Dabei steigen die Anforderungen an wiederaufladbare Batterien, sogenannte Akkumulatoren, stetig, gelten sie als Schlüsseltechnologie, damit die dringend benötigte Energie- und Verkehrswende gelingen kann. So gewinnen Forschung und Produktion nachhaltiger Batterien der Zukunft an Dynamik.
Intensive Forschung an umweltfreundlicheren Ausgangsmaterialien
Den Markt dominiert aktuell die Lithium-Ionen-Batterie. Sie besteht aus der Anode (Pluspol), einem Separator, der Kathode (Minuspol) und dem Elektrolyten. Wird die Batterie aufgeladen, wandern die Lithium-Ionen von der Kathode zur Anode und werden dort gespeichert. Die elektrische Energie, die währenddessen aus dem Stromnetz eingespeist wird, wird dabei in chemische Energie umgewandelt. Beim Entladevorgang, also beispielsweise während der Fahrt mit dem Elektroauto oder während der Smartphone-Nutzung, wandern die Lithium-Ionen zurück zur Kathode. Die chemische Energie wird dabei wieder in elektrische Energie umgewandelt.
Zu den Ausgangsmaterialen dieses Batterietyps zählen unter anderem chemische Substanzen wie Graphit in der Anode sowie Lithium, Kobalt und Nickel in der Kathode. Viele dieser Rohstoffe sind teuer, ihr Aufkommen in der Welt ist begrenzt und geographisch stark konzentriert. Zudem werden Umweltfreundlichkeit und die Sicherheit der Arbeitsbedingungen beim Abbau einiger Rohstoffe in vielen Ländern in Frage gestellt.
Ziel der Forschung ist es daher, diese Batteriematerialien durch andere zu ersetzen. Erste Erfolge haben sich insbesondere mit Blick auf Kobalt bereits eingestellt: Dessen Anteil in der Kathode von Batteriezellen konnte von 33 Prozent auf nun etwa drei Prozent gesenkt werden. Das Metall komplett durch deutlich umweltfreundlichere, organische Materialien auszutauschen, scheitert derzeit noch daran, dass geringe Mengen an Kobalt zur Stabilisierung der Gesamtperformance benötigt werden. Genau hier liegt die Krux beim Umstieg auf „grünere“ Materialien: Sobald eine Komponente ersetzt wird, wirkt sich das auf andere Komponenten der Batterie und damit schlussendlich auf ihre Leistungsfähigkeit aus. Weitere, intensive Forschung an neuen Batteriematerialien, die das Zusammenspiel aller Komponenten berücksichtigt, ist damit unerlässlich.
Produktionsprozesse neu denken
Nicht nur mit Blick auf die Ausgangsmaterialien prägt der Anspruch auf Nachhaltigkeit die Batterieforschung, auch Produktionsprozesse werden überdacht. Erste erfolgreiche Ansätze gibt es bei der Herstellung der Elektroden, also der Anode und der Kathode der Batterie. Früher wurden im Produktionsprozess teure, toxische organische Lösungsmittel eingesetzt, die heute erfolgreich und ohne Leistungsverlust durch Wasser als Prozesslösungsmittel ersetzt werden konnten. Es gilt, kontinuierlich jeden Arbeitsschritt im Herstellungsprozess einer Batterie auf den Prüfstand zu stellen und nachhaltig zu optimieren.
Nach wie vor ist der Energieverbrauch bei der Produktion wiederaufladbarer Batteriezellen groß. Da diese mit elektrischer Energie produziert werden, liegt es nahe, Energie aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind oder Solaranlagen zu nutzen.
Ein zweites Leben für die Batterie
Um den CO2-Fußabdruck der Batterie zu verringern, gibt es noch eine andere Strategie: den sogenannten Second-Life-Ansatz. Oftmals werden die Energiespeicher nicht bis zum Ende ihrer Leistungsfähigkeit genutzt. Anstatt die Batterie in einem solchen Fall zu entsorgen, kann sie in eine zweite, weniger anspruchsvolle Anwendung, ein sogenanntes zweites Leben, überführt werden. Erreicht die Batterie in einem Elektroauto beispielsweise nur noch 80 Prozent ihrer ursprünglichen Reichweite, kann sie ausgetauscht und als stationärer Speicher, zum Beispiel für die Hausphotovoltaikanlage, wiedereingesetzt werden. Das hat den großen Vorteil, dass die CO2-Emissionen der Batterie auf einen längeren Zeitraum verteilt werden.
Aber Vorsicht, nicht jede Batterie kann problemlos für einen anderen Zweck zum Einsatz kommen. Jeder Energiespeicher wird für eine spezielle Anwendung konzipiert. Wird er an anderer Stelle genutzt, muss im Vorfeld sichergestellt werden, dass er in diesem zweiten Leben nicht an Sicherheit einbüßt. Anpassungen sind in vielen Fällen notwendig. Der Second-Life-Ansatz erfordert damit immer auch eine detaillierte Vorab-Prüfung. Dabei muss immer gewährleistet sein, dass der Aufwand, eine Second- Life-Batterie zu konzipieren, nicht zu zu hohen Kosten für Fertigung und Prüfung führt – denn dann wäre eine neue, leistungsstärkere Batterie eigentlich die bessere Lösung.
Batterierecycling: aus Alt mach Neu
Eine andere Nachhaltigkeitsstrategie ist das stringente Recycling der Materialien. Schon heute sind hohe Recyclingquoten bei Batterien möglich. Doch auch in diesem Bereich sind Wissenschaft und Praxis noch mit großen Herausforderungen konfrontiert. Im Automobil etwa sind die Batterien je nach Hersteller unterschiedlich untergebracht. So gibt es schon für die Demontage kein einheitliches Verfahren, was das Recycling komplexer macht.
Ziel ist es außerdem, die Materialien qualitativ so hochwertig, das heißt, mit einem so hohen Reinheitsgrad, zu recyceln, dass sie als Ausgangsmaterialien für neue Batterien genutzt werden können. Hier bedarf es weiterer Forschung, um neue Methoden für den Recyclingprozess zu entwickeln bzw. bestehende Verfahren anzupassen.
Wichtig ist, Nachhaltigkeit in der Batterieforschung ganzheitlich und damit vom Ausgangsmaterial über die fertige Batterie bin hin zu ihrem Recycling zu denken, also über die gesamte „zirkuläre Wertschöpfung“. Die Forschung hat sich in den vergangenen Jahren bereits stark hierauf ausgerichtet und misst nachhaltigen Aspekten immer mehr Bedeutung bei. In diese Richtung muss (und wird) sich die Batterieforschung und -entwicklung weiterentwickeln.
Über den Autor:
Prof. Dr. Martin Winter ist Gründer und wissenschaftlicher Leiter des MEET Batterieforschungszentrums der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und des Helmholtz-Instituts Münster, einer Außenstelle des Forschungszentrums Jülich. Seit 30 Jahren forscht der Chemiker mit seinem Team entlang des gesamten Wertschöpfungskreislaufs von Batterien. Die Arbeit reicht von der Optimierung der bewährten Lithium-Ionen-Technologie über Weiterentwicklungen mit neuen Materialien bis hin zu vielversprechenden neuen Ansätzen wie Festkörper- und Lithium-Metall-Batterien.
Beitragsbild:
Das Copyright liegt bei istock/petmal.