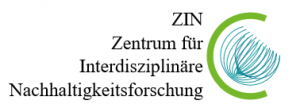Tobias Gumbert
Wie bei den meisten Menschen steht auch bei mir und meiner Familie regelmäßig das Ausmisten angesammelter materieller Güter an. Zuletzt bin ich mit mehreren Kisten alter Klamotten, insbesondere Kindersachen, die im privaten Kreis nicht weitergegeben werden konnten, Handtüchern, etc. zum Wertstoffhof gefahren, um die Altkleidercontainer zu befüllen. In vielen Städten und Kommunen ist es sinnvoller, sich mit der lokalen Infrastruktur – Kleiderkammern, Second-Hand-Läden – vertraut zu machen, da eine Spende hier direkt ankommt und der Verbleib der Artikel ansatzweise nachvollzogen werden kann. Doch im Alltag ist der Weg zum Wertstoffhof in der Regel oft der einfachere und zeitsparendere, da hier alles loszuwerden ist, was an Überflüssigem und nicht mehr Benötigtem die eigenen vier Wände verlassen soll. Hier ist in Bezug auf Kleidung jedoch in regelmäßigen Abständen das gleiche Phänomen zu beobachten: Aufnahmestopp, das heißt die gemeinsamen Container des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), der Arbeiterwohlfahrt (AWO) sowie der Christlichen Arbeiterjugend (CAJ) bleiben vorerst ungeleert. In der Regel bedeutet dies, dass die Sortierstellen überlastet sind. Das ist häufig im Sommer der Fall, da selten saisonal nutzbare Kleidung gespendet wird, und durch Corona-bedingte Aufräumaktionen in Privathaushalten waren diese Stellen zuletzt besonders überlastet. Also, was tun?
Ethisches Unbehagen
Die Antwort des Personals auf meine Frage, wie ich nun mit meinen Altkleidern verfahren solle, stürzte mich in ein ethisches Dilemma, denn meine Optionen waren: alles wieder mitnehmen und erneut in den bereits viel zu vollen Keller räumen, oder alles in den Restmüll werfen und damit noch gut zu tragende Kleidung dem gleichen Schicksal des übrigen Containerinhalts aussetzen – Verbrennung. Während die Kleiderspende durch die Hoffnung auf ein sinnvolles Weiterleben der Textilien die Abgabe relativ einfach macht, ist der Prozess des Überantwortens ebendieser an den Restmüll ungleich schwieriger umzusetzen. Nicht nur werden die überflüssigen Dinge auf einmal im Zusammenhang ihrer Geschichte betrachtet – „den Pulli habe ich eigentlich immer ganz gerne getragen, die Schuhe habe ich im Urlaub gekauft, das Hemd hat mir Mutti zum Geburtstag geschenkt“ – auch die persönliche Verantwortung wird uns schlagartig bewusst: Es ist meine Entscheidung, ob die Sachen nun zerstört werden, ich bin dafür verantwortlich, dass sie nicht mehr weiter genutzt werden und obendrauf auch noch im letzten Stadium ihres Lebens Emissionen verursachen. Dass dies woanders auf der Welt ebenfalls geschieht, wo meine Kleidung mit hoher Wahrscheinlichkeit landen und (mit Verzögerung) negative Umwelteffekte hervorrufen wird, ist mir ohne diesen „Entscheidungszwang“ in aller Regel kaum bewusst.
Leben und Tod
Dass diese Zusammenhänge häufig in der Sprache vom Leben und Tod der Dinge ausgedrückt werden, ist dabei nicht zufällig. Die Entwicklung oder Reise von Produkten wird wie selbstverständlich analog zum menschlichen Lebensverlauf gedacht. Produkte sind am Ende ihres „Lebenszyklus“ angekommen, politisch werden Strategien diskutiert, wie dieses Ende weiter nach hinten verschoben werden kann (Stichwort Nutzungsdauerverlängerung), und die wissenschaftliche Analyse der Umwelteffekte entlang der Produktions- und Lieferketten von Produkten nennt sich folglich „Life Cycle Analysis“. Auch das Bild des Zyklus, in dem Materialien am Ende ihres Lebens durch Recycling und Wiederverwertung so aufbereitet werden, dass aus ihnen wieder „neues Leben“ entsteht, erinnert an natürliche Abläufe in der Natur und spezifische religiöse Vorstellungen.
Auch der „Tod“ oder das „Sterben“ von Dingen werden zunehmend als Begrifflichkeiten verwendet, mit denen aktuelle Trends im Umgang mit Konsumgütern beschrieben werden. In den Feuilletons konnte man in den letzten Jahren immer wieder etwas über „Döstädning“ lesen, die schwedische Praxis des „death cleaning“. Dabei geht es darum, den individuellen Besitz vor dem eigenen Ableben so zu sortieren, dass die Nächsten nicht von der (emotionalen) Wucht der Hinterlassenschaften erfasst werden. Für wen ist es schon leicht oder angenehm, sich von den Erinnerungsstücken eines geliebten Menschen zu trennen? Dies bedeutet jedoch im Umkehrschluss, sich selbst mit dem Ausrangieren, Ausmisten, Weggeben und Verschrotten von Dingen beschäftigen zu müssen, die nicht selten voller Erinnerungen und Bedeutungen sind. Die zentrale Frage, die hier beim Sortieren hilft, ist: „Könnte es jemandem Freude bereiten oder Trost spenden, wenn ich dieses Ding hinterlasse?“ Allein diese Perspektive auf die angehäuften materiellen Dinge im Angesicht des eigenen Todes bietet mittlerweile vielen ausreichend Motivation, um „Decluttering“, also großangelegte Entrümpelungsaktionen, im Hier und Jetzt zu betreiben. Der Blick auf das Ende verspricht für viele mehr Klarheit im Alltag und einen Leitfaden, um für sich selbst zu entscheiden, was (und wie viel davon) genug ist für ein selbstbestimmtes, gutes Leben – und wo es zu viel ist (Stichwort: Suffizienz).
Neben dem Entrümpeln ist auch das Aufräumen und saubere Ordnen der Dinge in den eigenen vier Wänden, häufig unter Anleitung selbsternannter Home Design Expert*innen, zu einer „hippen“ Praxis avanciert. Allen voran lehrt die Japanerin Marie Kondo, egal ob durch ihre internationalen Bestseller oder ihre Hochglanz-Netflix-Dokus, wie jede*r mittels ihrer patentierten „KonMari-Methode“ mehr Ordnung, Ruhe und Zufriedenheit in das eigene Leben einsortieren kann. Eine einfache, mittlerweile geflügelte Formel soll dabei helfen, die Beziehung zu den Gegenständen in der eigenen Wohnung zu ergründen: „Does it spark joy? – Bereitet dieses Ding Freude?“ Ist die Antwort ja, darf es getrost an Ort und Stelle weiterwohnen; ist die Antwort nein, wird sich höflich bei ihm bedankt, um den Gegenstand anschließend (idealerweise) weiterzugeben oder zu verschenken. In Anlehnung an japanische Traditionen des Shintoismus werden die Dinge von Marie Kondo behandelt, als wäre ihnen eine eigene Lebendigkeit, eine eigene Vitalität zu eigen, die uns berühren kann, aber die gerade deswegen auch mit Respekt zu behandeln ist.
Reduktion vs. Permanenter Austausch
Aus Sicht der Nachhaltigkeitsforschung sind viele Aspekte an diesen Trends interessant, etwa inwiefern Akteure der Kreislaufwirtschaft materiellen Gütern „neues Leben schenken“ wollen, um ihre Tätigkeiten als moralisch gut zu präsentieren, oder inwiefern die Praktiken des „death cleaning“ und die Faszination minimalistischer Lebensstile Ausdruck einer überforderten Gesellschaft sind, die sich selbst konstant von Lasten befreien und niemandem zur Last werden möchte. Mich selbst interessieren an dieser Stelle insbesondere die Verbindungslinien zu Konsumpraktiken und das Potenzial eines nachhaltigeren Umgangs mit Konsumgütern.
Chamberlin und Callmer (2021) interviewten Praktizierende der KonMari-Methode und stellten dabei veränderte Beziehungen zu materiellem Besitz, eine erhöhte Zufriedenheit bezüglich der Wohnsituation, eine Sensibilität für suffiziente Lebensstile (also ein Leben mit Orientierung an Fragen des Genügens und Genug-seins) sowie allgemein ein gesteigertes Wohlbefinden fest. Die Autorinnen sind vorsichtig optimistisch, dass diese spirituelle Herangehensweise an die Dinge eine Reduktion des Materialverbrauchs nach sich ziehen könne, auch wenn eine tatsächliche Reduktion in diesen Haushalten nicht erhoben wurde. Skeptischer ist hingegen Cristy Lang Hearson (2021), die in dieser Hinwendung zum Spirituellen in Konsumfragen nicht nur positive Aspekte entdeckt. „Decluttering“ helfe Menschen sichtlich dabei, Scham- und Schuldgefühle als Resultat eines ständigen „Zuviel“ in der Überflussgesellschaft erfolgreich zu bearbeiten bzw. zu verdrängen. Gleichzeitig entstünde jedoch durch die Hinwendung zu einem „ästhetischeren Selbst“ (das heißt z.B. Wert zu legen auf klare Formen in der Inneneinrichtung, alle Schränke und Schubladen mit Sortiereinsätzen auszustatten, etc.) ein starker Sog, neue Dinge anzuschaffen, die sich nahtloser in den neuen Lebensentwurf einfügten. Als Konsequenz werden weiterhin konstant Dinge aussortiert und neu erworben – unter Umständen sogar mehr als zuvor. (Dadurch wird gleichsam deutlich, dass diese „Probleme“ des Überflusses insbesondere auf eine ökonomisch sehr privilegierte Gruppe zutreffen. Das Ausmisten und Ersetzen von Konsumgütern muss man sich leisten können).
Eine veränderte Beziehung zu den Dingen?
Diese knappe Gegenüberstellung verdeutlicht bereits, dass die neuen Aufräum-Trends und die Rhetorik vom Leben und Tod der Dinge nicht automatisch zu nachhaltigerem Konsum führen. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass uns materielle Dinge des Alltags auf Schritt und Tritt begleiten und wie selbstverständlich mit uns in Beziehung treten. Der vor kurzem verstorbene französische Soziologe und Philosoph Bruno Latour erinnerte daran, dass die Dinge von sich aus ihre Aufgaben und To Dos an uns herantragen: Sie müssen gekauft, geputzt, aufgeräumt, geordnet, gesammelt, verstaut, gestapelt, sorgfältig genutzt, repariert oder aussortiert werden. Die Beschäftigung mit Dingen kann so zu einem sich selbsterhaltenden Kreislauf werden, welcher den Menschen regelmäßig erschöpft zurücklässt und ihm die Zeit für die Pflege menschlicher Beziehungen raubt. Auch wenn die Sprache vom Leben und Tod der Dinge für einzelne seltsam anmuten mag und sicherlich auch kritisch zu sehen ist, so zeigen erste Studien, dass sie doch dabei helfen kann, unsere eigenen Beziehungen zu Dingen (und darüber zu anderen Menschen) zu reflektieren und gegebenenfalls wichtige Weichenstellungen für veränderte Gewohnheiten vorzunehmen.
So verleitete der Container auf dem Wertstoffhof mich ebenfalls zu einem Kompromiss: Ich nahm, eher unbewusst doch ganz im Sinne Marie Kondos, alle Kleidungsstücke noch einmal in die Hand und überlegte, was zu tun sei. Der Blick war hier jedoch eher rückwärtsgewandt als gegenwartsbezogen: Haben die Dinge mich in der Vergangenheit so glücklich gemacht, dass sie auf jeden Fall woanders weiterleben sollten und den plötzlichen Tod nicht verdient haben? Einige Dinge wurden daraufhin von mir zum Ende in der Restmüllpresse verdammt, andere wurden wieder eingepackt und fristen derzeit ein Zwischen-Dasein in meinem viel zu vollen Keller – jedoch mit der festen Absicht, sie einer anderen Bestimmung zuzuführen. Die Situation hat mich dazu gebracht, mir noch vehementer als bislang die Frage zu stellen, ob ich ein Ding wirklich brauche – hauptsächlich um zu vermeiden, in Zukunft wieder mit dem gleichen Unbehagen und einer viel zu vollen Kiste vor dem Wertstoff-Container zu stehen.
Literatur:
Chamberin, Lucy und Asa Callmer. 2021. „Spark Joy and Slow Consumption: An Empirical Study of the Impact of the KonMari Method on Acquisition and Wellbeing.” Journal of Sustainability Research 3(1), S. 1-31.
Lang Hearlson, Cristy. 2021. „The Invention of Clutter and the New Spiritual Discipline of Decluttering“. International Journal of Practical Theology 25(2), S. 224-242.
Latour, Bruno. 2007. Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Frankfurt am Main.
Zum Weiterlesen:
Zum Thema Suffizienz wurden auf diesem Blog bereits verschiedene Beiträge veröffentlicht. Unter diesem Link findet ihr eine Übersicht.
Über den Autor:
Tobias Gumbert ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Internationale Beziehungen und Nachhaltige Entwicklung am Institut für Politikwissenschaft und am Zentrum für Interdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung (ZIN) der Universität Münster.
Beitragsbild:
Pixabay-Lizenz