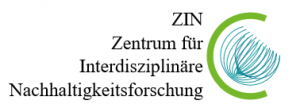Hans Beck
Vorwort: Zu viel und zu wenig Wasser – beides kann, wie Hans Beck im folgenden Blogartikel illustriert, zur existenziellen Bedrohung werden. Zwar mag der idyllische Blick auf das Heiligtum der Hera bei Perachora (Griechenland) im Titelbild (© Hans Beck) nicht erahnen lassen, dass der Tempelbezirk unter dauerhaftem Wassermangel litt. Schon im antiken Griechenland jedoch haben Menschen die Erfahrung von zu viel und zu wenig Wasser gemacht. Und Menschen machen diese Erfahrung trotz technischen Fortschritts auch heute – nicht nur in weit entfernten Regionen der Erde. Klimatische Veränderungen machen sich unlängst auch in Deutschland bemerkbar, etwa durch Starkregen und Überflutungen oder die Zerstörung wertvoller Lebens- und Naturräume durch Waldbrände infolge langer Dürreperioden. Dabei zeigt sich damals wie heute: Existenzielle Bedrohungen erfordern nicht nur technische, sondern benötigen und bringen auch politische, soziale und kulturelle Antworten hervor. Hans Beck veranschaulicht, welche Vielfalt an Resilienzsstrategien sich in der griechischen Antike entwickelt hat, die technische Entwicklungen, aber auch die politische Organisation des Zusammenlebens und antike Kultur maßgeblich geprägt haben.
Auf den griechischen Dichter Pindar geht das geflügelte Wort zurück „Wasser ist das Beste“. Pindar hatte dabei wohl vor Augen, dass im antiken Griechenland beinahe überall notorischer Wassermangel herrschte. Wenn ein Ort es hergab, konnte Frischwasser aus Flüssen und Felsquellen geschöpft, die Versorgung womöglich durch Brunnenanlagen und Zisternen ergänzt werden. Städte wie Athen und Theben hatten hier noch einigermaßen gute Ausgangsbedingungen. Ansonsten ging es trockener zu. Auf Aigina, einer Insel im Saronischen Golf, gab es gar keine Frischwasserquellen. Der Hauptort wurde über eine Wasserleitung versorgt, die an ein Netz von Zisternen in den Bergen angeschlossen war; die Insel bezog bis ins frühe 20. Jahrhundert ihr Frischwasser durch Tankschiffe vom Festland. Im berühmten Heiligtum der Hera bei Perachora am Korinthischen Golf wurde ein ähnlich aufwendiges Ressourcenmanagement betrieben, mit dem sich der Tempel gegen die Dürre des Umlandes stemmte. Andernorts liefen die Menschen bis zu fünf Kilometer in eine Richtung, um Wasser aus dem nächsten Fluss zu schöpfen. Die Aussicht auf eine prosperierende Zukunft war unter solchen Bedingungen begrenzt. Gegen die Aufgabe der Siedlungsplätze stand nur die Tatsache, dass es woanders auch nicht leichter war. Es galt, sich mit den lokalen Gegebenheiten einzurichten und das Beste daraus zu machen.
Die Erschließung und Verteilung von Wasserressourcen waren somit prekäre Handlungsfelder. Einerseits war der Bau von monumentalen Versorgungsstrukturen arbeitsintensiv und insofern kostspielig. Zum anderen fielen die im 7. Jahrhundert v.Chr. einsetzenden ersten Großprojekte – zum Beispiel in Megara, Athen oder Korinth – in eine Zeit, in der der neue Urbanisierungsschub Hand in Hand ging mit der Entwicklung von Ideen gleicher Teilhabe am Gemeinwesen. Der Zugang zum Wasser wurde so zum kultur- und gesellschaftsprägenden Moment.

An den Wasserinfrastrukturen lassen sich wichtige Grundzüge der griechischen Kultur insgesamt ablesen. Erstens zeugten die Projekte von Kreativität und technischem know how – in Pergamon wurde beispielsweise eine Bodensenke von beinahe 200m durch eine hydraulische Druckleitung überwunden. Zweitens signalisierten sie eine neue urbane Ästhetik. So kam es etwa bei der Ausgestaltung monumentaler Brunnenhäuser zu einem regelrechten Überbietungswettbewerb, in dessen Folge der öffentliche Raum der Stadt mit immer imposanteren Gebäuden ausgestaltet wurde. Drittens vollzog sich all dies vor dem Hintergrund schwieriger – und wiederum öffentlicher – sozialer Aushandlungsprozesse. Wenn die Entstehung der griechischen Polis („Stadtstaat“) eng mit der Schaffung kommunaler Infrastrukturen verbunden war, dann galt das für Projekte zur Wasserversorgung in besonderer Weise. Denn neben den gemeinsamen Anstrengungen zur Realisierung standen die Fragen im Raum, wer überhaupt Teil der Gemeinschaft war, wer welche Privilegien genoss, und wie die stakes und benefits verteilt wurden. Wasserprojekte schufen Kommunalität, aber sie beförderten auch Dynamiken von Macht und Ausgrenzung. Kurzum: Wasser war hochgradig politisch.
Ressourcenknappheit und prekäre Verteilungsfragen legten es nahe, daneben auf religiöse Resilienzstrategien zu setzen. Zahllose Flussgottheiten bevölkerten das griechische Pantheon, dessen Obergott Zeus auch mit dem Beinamen Ombrios, „der Regenmacher“ verehrt wurde. Hinzu kamen mindestens ebenso viele Wassernymphen, die Naiaden, die über Frischwasserquellen wachten und den Wohlstand der Stadt symbolisierten. In Halikarnass, heute Bodrum, wurde die lokale Wassernymphe Salmakis in einem Brunnenhaus verehrt, das Wasserreservoir und heilige Stätte zugleich war. Die Quelle galt als Keimzelle der pulsierenden Stadt. Eine lange Inschrift aus dem 2. Jahrhundert erläutert die Zusammenhänge: je reicher die Halikarnassier Salmakis ehrten, desto reicher sprudelte die Quelle.

Andere Beinamen der Götter verraten, dass es vereinzelt auch zu viel Wasser gab. Auf der Peloponnes wurde Poseidon in Troizen mit dem Beinamen Phytalmios verehrt, „Beschützer der Pflanzen“. Konkreten Schutz suchten die Bewohner*innen von Troizen vor Salzwasserüberschwemmungen im flachen Küstenland. Die reichen Alluvialböden dort sicherten den agrarischen Ertrag Troizens, aber sie waren auch anfällig für Meerwasserinfiltrationen.
Das prominenteste Beispiel solcher Gefahren für die nachhaltige Feldwirtschaft stammt aus der mittelgriechischen Landschaft Boiotien. Der dort zentral in einer Beckenlandschaft gelegene Kopais See ist auf Karten zur Antike immer unterschiedlich groß abgebildet. Grund dafür sind die dynamischen Bewegungen der Küstenlinie. Bei Schwankungen des Wasserspiegels um +/- zwei Meter in der Marge von 91 und 95 Metern über NN verlor der See mehr als die Hälfte seiner Wasseroberfläche. Je nach Niederschlagsmenge in den Wintermonaten vergrößterte oder verkleinerte sich der See also. Die Gefahr von Überschwemmungen war omnipräsent. Lange Dürreperioden im Sommer verwandelten das Gebiet dagegen in eine Sumpflandschaft. Die Gesundheitsrisiken waren hoch. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts galt die Region als Malaria Hotspot.
Im Kopaisbecken waren besondere Resilienzstrategien gefragt. Die offensichtlichste – und auch kniffligste – war die Kontrolle des Wasserspiegels durch hydrologische Baumaßnahmen. In der späten Bronzezeit (15. bis 12. Jahrhundert v.Chr.) gelang dies durch die Einrichtung eines Systems unterirdischer Abwasserkanäle, sogenannter katavothres. Diese leiteten überschüssige Wassermengen im Nordosten des Beckens in Richtung einer niedrigeren Seeplatte. Die katavothres waren aber wartungsintensiv, sie waren anfällig für Verstopfungen. Mit dem Fall der bronzezeitlichen Paläste brachen auch die notwendigen Arbeitsstrukturen weg. Die katavothres verfielen.
Die Ingenieure Alexanders des Großen und danach die der Römer scheiterten am Versuch der Reaktivierung. Das Projekt wurde erst im 19. Jahrhundert wieder aufgegriffen und nacheinander von deutschen, französischen und englischen Ingenieurteams umgesetzt. Heute ist der See ganz trockengelegt. Ein über 650 Meter langer, weitgehend unterirdisch verlaufender Kanal leitet das Wasser ab. Auf diese Weise werden etwa 25.000 ha Ackerland gewonnen.

Wo dem Machbaren Grenzen gesetzt waren, brauchte es andere Antworten auf die Herausforderungen der Umwelt. Eine war, keine Siedlung unter 110m NN anzulegen. Alles unterhalb dieser Linie war zu nahe am beweglichen Seeufer. Das Beispiel der Zitadelle von Gla führte die Gefahren vor Augen. Ursprünglich umgeben von Wasser bei durchschnittlich 96 m NN gebaut und wohl über eine Landbrücke erreichbar, solange der Pegelstand des Sees unter Kontrolle war, diente der Ort als großflächiges Depot zur Lagerung von Weizen und anderen Erträgen. Mit dem Ende der Wasserregulierung war die Festung nicht nur Überschwemmungen ausgesetzt, sondern konnte bei Trockenheit unkontrolliert über Land erreicht werden. Das Ende der katavothres besiegelte auch das Schicksal von Gla.

Die 110 m NN Linie war für nachhaltige Siedlungen nicht verhandelbar. Im Sommer wurden die Aktivitäten, soweit das ging, auch in höhere Lagen verlegt, um den Stechmücken und damit der bereits genannten Malariagefahr auszuweichen. Auch von dort aus blieb der See Fokus des täglichen Lebens. Die Feuchtgebiete am Ufer boten ideale Wachstumsbedingungen für Schilfrohr – in der Antike eher ein Spartenrohstoff, genutzt vor allem für Schreibwerkzeuge. Daneben wurde Schilfrohr kunstvoll zu sogenannten auloi verarbeitet („Doppelflöten“), zwei leicht konisch gebohrte Rohre, die, im Winkel aneinandergesetzt, virtuose Melodien ermöglichten. Der durchdringende Sound des aulos war weit beliebt, er galt als emblematisch für Ekstase: bei Fest und Tanz, beim Symposium, aber auch beim Militär.

Die Umweltbedingungen machten das Kopaisbecken zu einem Schilfrohr-El Dorado! Die Beckenbewohner*innen machten sich diesen Vorteil zu eigen. Der antike Autor Theophrast aus Lesbos beschreibt, wie sich die von ihnen forcierte Schilfrohrindustrie in eine lokale Kulturlandschaft übersetzte, die vom Anbau des Naturproduktes und dem Handwerk der Herstellung der Flöten geprägt war; beides wurde im großen Stil und mit viel Verve betrieben. Dazu gehörten auch Experimente mit neuen Modulationen und Tonleitern, die die Aulosmusik insgesamt veränderten. Möglich wurde das durch leistungsfähige Mundstücke, für die es besonders hochwertiges Schilf brauchte. Auloi aus dem Kopais waren ein Exportschlager, high end in Machart und Material, und reich an Melodien, die professionelle Auleten überall in Griechenland aus ihnen herausholten.
Kulturelle Prozesse wurden in der griechischen Antike von der lebendigen Dynamik zwischen beinahe endlos vielen lokalen Welten bestimmt. Dass es dabei hier zu wenig, dort zu viel Wasser gab, zeitigte elementare lokale Unterschiede – und erzeugte spannende Dialoge zwischen ganz unterschiedlichen Handlungsfeldern, zwischen technischem Fortschritt, politischer Organisation des Zusammenlebens, wirtschaftlicher Entwicklung und kultureller Innovation.
Über den Autor:
Hans Beck (Dr. phil. Erlangen 1996) ist Professor für Griechische Geschichte im Seminar für Alte Geschichte. Stationen vor Münster waren Köln, Frankfurt, Washington DC und Montreal. Zu seinen zentralen Forschungsfeldern gehört die Umweltgeschichte Griechenlands, in Münster leitet er hierzu die Arbeitsstelle Epichorios. Historische Landeskunde des antiken Griechenlands. Für weitere Info, siehe www.hansbeck.org.